@Zarbon000
vor 2 Wochen
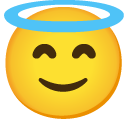
Der Wasserwandel
Faktisch "physisch" und damit "physisch" erklärbar ist
genau: garnichts
Denn jede "physische Erklärung" setzt voraus: Kausalität.
Doch genau diese existiert faktisch: nicht.
Seit geraumer Zeit meine Lieblingsrubrik ...
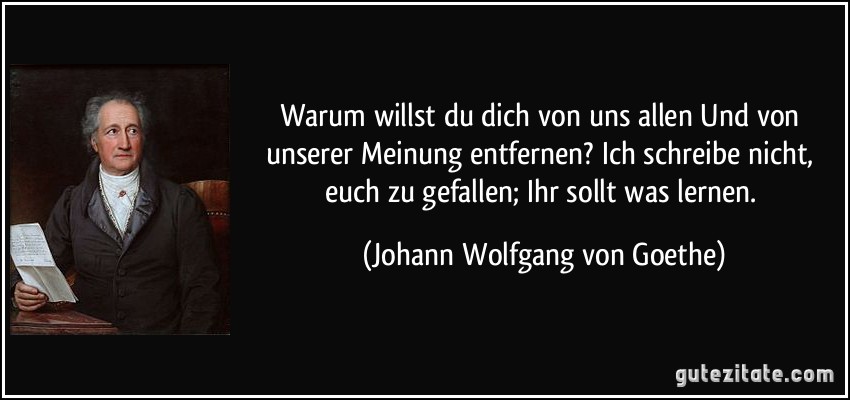
| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."
heisenberg, w. Zit in byrne 2012, S. 113.
|
|
"Bei einer Messe in Stuttgart kam ich mit einem bekannten Chemiker ins Gespräch. Ich versuchte ihm zu erklären, daß wir mit dem ausgestellten System Schwermetalle bis zu einem nicht mehr meßbaren Grade reduzieren können. Es handelt sich hierbei nicht um ein Filtersystem, sondern um einen durch Informationsübertragung hervorgerufenen Effekt, der die Selbstheilungskräfte des Wassers aktiviert. Wir haben derartige informationstechnische Trinkwasserreinigungssysteme in einem durch eine Ölraffinerie verpesteten Gebiet in Ecuador installiert. Die Schwermetallbelastung des Regen- und Grundwassers durch Blei und Quecksilber war derart hoch, daß die Menschen in den umliegenden Dörfern reihenweise erkrankten. Die Wirkung des von uns installierten Systems wurde damals durch wissenschaftliche Meßreihen begleitet und bestätigt, das Resultat läßt sich aber auch in wenige Worte packen: klares Trinkwasser mit signifikanter Reduktion von Schwermetallen! Ich erinnere mich noch genau daran, wie ihn diese Erklärung zur Weißglut brachte. Was ich da sage, so der Sachverständige, könne es alles nicht geben! Ich bot ihm kurzerhand an, daß er das System mit meinen Produkten gerne bei sich im Labor testen könne.
Gleichzeitig fragte ich ihn aber auch, was er denn machen würde, wenn er am Ende tatsächlich auf dasselbe Ergebnis käme; er würde es, so sagte er, dennoch nicht glauben, denn was ich von mir geben würde, könne einfach nicht sein, da sonst die ganzen wissenschaftlichen Denkmodelle falsch wären ! Bei ihm stapelten sich die Bücher, und viele nahm er zur Hand, um mir meinen Irrtum deutlich zu machen. „Roland“, sagte er, „hier steht überall, daß das nicht sein kann, was du da machst !“
|
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
Prof. tuscott, Australian National
University, 27 Mai 2015
"Experiment confirms quantum
theory weirdness" (link)
https://health.anu.edu.au/news-events/news/experiment-confirms-quantum-theory-weirdness
|
In his autobiography, Wheeler describes being successively in the grip
of three metaphysical ideas: Everything Is Particles, Everything Is
Fields, and then, at the end of his career, Everything Is Information.
Elaborating on the last of these ideas, Wheeler wrote: “The more I have
pondered the mystery of the quantum and our strange ability to
comprehend this world in which we live, the more I see possible
fundamental roles for logic and information as the bedrock of
physical theory.”
|

|
Der allerbeste Vortrag von tom, welchen ich kenne, hinsichtlich "einmal alles in eine Nussschale gepackt" - jetzt endlich auf Deutsch ! Bevor ihr also irgendwas zu lesen anfangt, hört diesen Vortrag zu aller Erst. Denn er erleichtert das Verständnis einer auf information beruhenden wirklichkeit enorm. Versprochen !
|
Chronologisch zu lesen, also, es begann am 24.10.2022, naja, und
das "Neueste" ist dann immer der letzte Artikel.
Aber - es baut aufeinander auf, wer also nicht vertraut ist mit der "Physik" der
information ("Quantenphysik"), der tut gut daran, von Anfang an zu lesen.
Das aktuelle Jahr
Hier die Beiträge aus: 2024 2023 2022
14.01.2025 n. Chr. 09.34 Uhr nach
Sommerzeit.
"In der Nähe unseres Ferienhauses in Tisvilde wohnt ein
Mann, der hat über der Eingangstür seines Hauses ein Hufeisen angebracht, das
nach einem alten Volksglauben Glück bringen soll. Als ein Bekannter ihn [niels
bohr] fragte: «Aber bist du denn so abergläubisch? Glaubst du wirklich, daß das
Hufeisen dir Glück bringt?», antwortete er: «Natürlich nicht; aber man sagt
doch, daß es auch dann hilft, wenn man nicht daran glaubt.»
werner heisenberg, Der Teil und das Ganze"
Immerhin noch 9,4°C in der Bude, und holla, ich habe mir eine beleuchtete Cherry MX (braune Taster) gekauft, was das für einen Unterschied macht, denn ich muss halt immer noch auf die Tastatur glotzen, mit meiner 1-2 Finger "Technik". In den dunklen Monaten wirklich hilfreich, denn ich kann einfach morgens kein unnatürliches Licht wie im Krankenhaus ab.
Und ja, "das "Atom"-Modell gilt schon lange nicht mehr ..." hans peter dürr in seinen Vorträgen nicht müde wurde, in seinen Vorträgen zu wiederholen, nur hatte ich diese Aussage damals, als ich mir seine Vorträge anhörte, nicht so gemerkt, es war mir wohl Anderes wichtig. Jetzt erst habe ich es so richtig verarbeitet, prozessiert, sozusagen, dass das typische bohrsche Atom-Modell ! nicht mehr gilt, oder zulässig ist, da keine der uns bekannten "Kräfte", also auch die elektrische nicht (welche die einzige ist, welches für dieses Modell in Frage kommt), solch ein Modell rechtfertigen kann. So hat mich gestern dann luca gefragt, wie man denn sich das sonst vorstellen könnte, worauf ich keine Antwort hatte. Denn auch ich bin ja mit der "Muttermilch" auf dieses Modell hin indoktriniert worden, bis eben vor ein paar Tagen es bei hans peter dürr klar wurde, dass dieses Modell schon lange nicht mehr gilt.
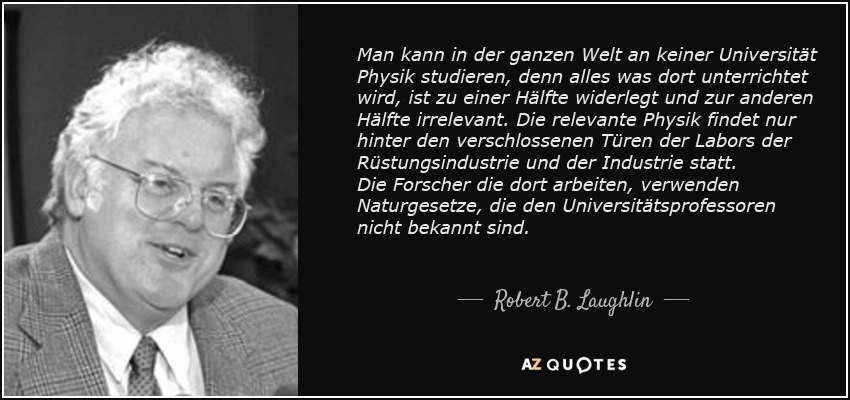
Gut, klar, im Grunde "gelten" tut ja überhaupt nichts, was die (materielle) Wissenschaft uns glauben machen will, da hier ja überhaupt nichts materiell ist, es gibt keine Materie, also kann auch keine Erklärung, welche auf Materie (oder "Wellen" oder "Energie" etc.) beruht, eine faktische "Erklärung" sein.
Das einzige, was die materielle "Wissenschaft" hervor
bringt, sind:
Metaphern
Oder Wortbilder, Analogien, was weiß ich, doch jedenfalls liefert die alte, überkommene, newtonsche "Wissenschaft" nichts faktisches, sondern höchstens etwas, was man als allegorisch bezeichnen könnte.
So "die Wissenschaft" mit ihren letztlich größeren oder kleineren Wortbildern letztlich "Geschichtchen" erzählt, ohne aber dieses klar zu kennzeichnen (wie etwa jesus es gemacht hat, "ich rede in Gleichnissen"). Hier kommt ein gewisses "Geschmäckle" in die Sache ...
Man fühlt Absicht, und ist verstimmt
goethe
Worin ich halt keine Einsicht hatte, war, dass das "Atommodell" selbst nach deren eigenen "Gesetzen" nicht funktioniert. "Die elektrischen Kräfte geben das nicht her" - hans peter dürr. Da eh ja alles hier nur virtuell ist, somit ohnehin nichts, was die (newtonsche) "Wissenschaft" sagt, faktisch war ist, dass ist ja ohnehin klar, doch, wie gesagt, ich wusste nicht, dass dieses Atom-Modell selbst innerhalb der newtonschen "Wissenschaft" garnicht möglich ist. Aber gut, von solchen "Hard-Problems" ist ja die "Wissenschaft" voll davon.
„Es ist wichtig, einzusehen, daß wir in der heutigen Physik nicht wissen, was Energie ist.“
richard
feynman
Wie denn auch ?
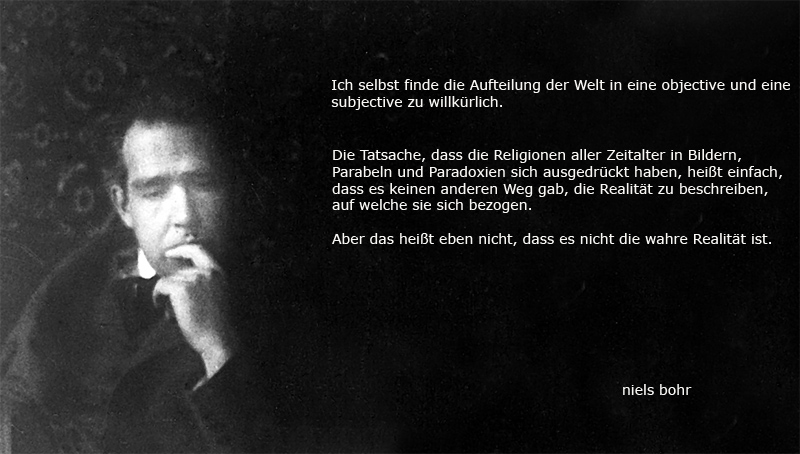
Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeutete. Er wusste nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte: „Wohin reitet der Herr?“ „Ich weiß es nicht“, sagte ich, „nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.“ „Du kennst also dein Ziel“, fragte er. „Ja“, antwortete ich, „ich sagte es doch: ‚Weg-von-hier‘ – das ist mein Ziel.“ „Du hast keinen Eßvorrat mit“, sagte er. „Ich brauche keinen“, sagte ich, „die Reise ist so lang, daß ich verhungern muß, wenn ich auf dem Weg nichts bekomme. Kein Eßvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.“
franz kafka
Das ist wohl der Punkt, und ich werde es in Telefonaten auch nicht müde, zu wiederholen - "kein Eßvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise". Denn wir alle hier wissen, dass hier, also was wir hier erleben, als wirklichkeit oder besser "Welt" erleben, hat die Solidität und Echtheit eines Luftschlosses. In Indien man es schon ganz gut fasst, als "Maya", eine Scheinwelt, in welcher wir alle Akteure auf einer Bühne sind, nicht mehr, allerdings auch nicht weniger. So sind wir angehalten, ein jeder auf seine Weise ein klein wenig am stück mitzuwirken, und können uns freuen, dass wir dieses nicht auf ewig aufführen müssen. Das Publikum ist gott, und so sollte man halt sein Bestes geben ...


|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
25.01.2025 n. Chr. 09.37 Uhr nach Sommerzeit.
"One becomes exactly what one's mind dwells on intensely and
with firm resolve."
bhagawan nityananda
11,1°C in der Bude, 12°C soll es "draußen" werden, also das ist zuviel für die Latzhose, ergo wieder in nicht ganz so isolierende Klamotten geschlüpft. Bestimmt schon 2 Stunden wach, und viele Gedanken liefen an meiner inneren Kamera vorbei. So langsam freunde ich mich damit an, dass ich wahrscheinlich nur sehr indirekt der Urheber der Gedanken bin, sondern diese als Angebot geschickt werden aufgrund der vorherrschenden innerlichen Ausrichtung (Intention). Allerdings an die eigene Intention heran zu kommen, und diese bewusst neu auszurichten, ist eher ein schwieriges Unterfangen, weil diese ja irgendwie auch mit dem Charakter verbandelt ist, von welchem man bisher ja immer behauptet hat, dass dieser unabänderlich sei, respektive Charakter gleich von vornherein so definiert ist.
Dochg das hatte ich vor einiger Zeit schonmal geschrieben, dass aber zu vermuten ist, dass wir (auch) aus diesem Grunde hier zu sein scheinen, nämlich das unmöglich scheinende hier wenigstens zu versuchen, nämlich innerhalb eines lebens, eines Durchganges buchstäblich ein anderer zu werden, wenn auch nur in einem mikroskopisch kleinem Schritt. Das würde innerhalb der Reinkarnationslehren auch erklären, warum alles so ewig lange braucht - weil es einfach so unglaublich schwer ist, sich essentiell, also im Wesen, in der "seele" zu ändern. So redet man ja auch von "großen seelen", um wesen mit hervorstechenden ("guten") Eigenschaften zu kennzeichnen, wir also durchaus Graduierungen der "Seelenbeschaffenheit" kennen, wahrnehmen.
Zu den mir präsentierten Gedanken gehört auch das sich um Pergamon Rankende, also den Sitz satans, welcher um 1900 in der Türkei von einem Deutschen gefunden und ausgegraben wurde, der auch noch humann hieß, naja, gott hat humor. So mpräsentiertenh sich mir Überlegungen, ob es nicht damals einfach dazu gehört hatte, dass satan ein ganz normaler Bestandteil des Spieles war, und sogar ganz leibhaftig, mit Angestellten, Volk und pi pa po. Also als derjenige, dasjenige, was all den "Anderen" das leben schwer zu machen die Aufgabe hat. Unruhe, Krieg, Krankheiten, Brunnen vergiften, Tod und Teufel bringen, dafür Pergamon das Hauptquartier war. Und die menschen wussten das auch, es ein "offenes Geheimnis" war. Doch mit der weiteren Aufklärung des menschen und seiner zunehmenden Rationalität und schnelleren Verbreitung von Wissen, auch mit der Bildung von "Staaten" dieser eher mystische und zunehmend anachronnistische Ansatz (des "Bösen") dann in der Versenkung verschwand, satan, seine Angestellten und Volk sich unter die menschen mischten, und so dieses mystische Konzept in Vergessenheit geriet. Pergamon so nach und nach unter den Sandmassen verschwand, vergessen wurde, dass es mal solch eine Einrichtung "ganz offiziell" gab (Gegenstromanlage).
"Damals" hätte man es dann also noch eher gemerkt, dass diese wirklichkeit einem Videospiel gleicht, mit "dahinten, hinter den Bergen, da leben die Monster". Ähnlich wie bei Herr der Ringe, welche Erzählung ja auch eher einem Onlinegame ähnelt, denn Zuständen, welche wir vorfinden Übrigens kann daher auch noch die Flacherd-Geschichte stammen, denn ich kann mir vorstellen, dass aus Gründen der Einfachheit und geringeren Betriebsaufwandes das Ganze hier anfangs schon als "Brettspiel" aufgebaut war (wie ja auch jedes Computerspiel mehr oder minder ein Brettspiel ist.). Doch auch hier mit der zunehmenden Erkenntnis und den beginnenden Wissenschaften, Zunahme der Teilnehmer, der Exploration dann irgendwann auf das Kugelmodell umgestellt werden musste. Und vielleicht deswegen noch hie oder da Reminiszenzen der alten Programmierung noch zu entdecken sind ?
"Far out" ... würde ram dass sagen, aber da hier halt überhaupt garnichts physisch ist, brauche ich ja auch garnicht erst anfangen
auch nur irgendwas
"physisch" erklären zu wollen. Jeder "physische" Ansatz einer "Erklärung" ist immer: falsch.
| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."
Heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.
|
Naja, und dann natürlich auch die Erzählungen mit jesus und satan ganz normal Bestandteil dieser wirklichkeit sein können, oder gewesen sein können, weil der sichtbare "online-Game-Charakter" von wirklichkeit damals noch weit eher zugelassen wurde (wie es ja zum Teil bis vor kurzem in Indien noch gut sichtbar war). Nicht, dass man diesen Charakter auch heute nicht erkennen könnte, doch man muss schon weit genauer hinschauen, und auch viel mehr sich diesem Aspekt widmen, als sogar noch vor kurzer Zeit, als es zum Bespiel noch einen Bhagawan nityananda gab (Lehrer von swami muktananda). Er wird auch gurudev genannt. Jetzt weiß ich endlich, wen der "verrückte" bill mcdonald (hier bei anthony chene !) meint, wenn er sagt "gurudev, mein guru".
"Die Einheimischen sahen ihn auf dem Wasser des Flusses
Pavanja wandeln.
Viele Male speiste er Tausende von Menschen mit Süßigkeiten,
und niemand hatte die geringste Ahnung, woher die Süßigkeiten kamen."
"Nityananda loved solitude and he lived alone. He usually travelled on foot,
moving through the woods and mountains with lightning speed. People say he could
move from one place to another at the speed of thought."
"He built many caves and houses without taking money from anyone. He would tell
the workers to take their wages from under any stone in the jungle, and they
used to get the right amount.
When the ashram was being built in Kanhangad, the police came to investigate.
They wanted to know where Gurudev (Nityananda) was getting the money. He led the
police through the wild jungle to a lake full of crocodiles, jumped into the
water, and pulled out bundle after bundle of brand-new rupee notes, which he
tossed to the police. Frightened and astonished, the policed bowed to him and
ran away."
"Occasionally Gurudev would get on a tain. If he was asked for a ticket, he
would produce thousands of tickets from his loincloth. If he was asked to get
off, the train would stop and not run anymore."
"Local people saw him walking on the waters of the Pavanja River. Many times he
fed thousands of people with sweets, and no one had the slightest idea where the
sweets came from."
Dass ! in Indien der Onlinegame-Charakter von wirklichkeit noch weit eher sichtbar, erfahrbar ist, liegt aber wohl auch daran, dass die Inder mehrheitlich dieses Modell auch verinnerlicht haben, wiewohl es halt mit einem anderen Namen benennen. Würde "im Westen" über die einzelnen Player und deren Geisteshaltung sich auch nach und nach solch eine Entstellung zum Charakter von wirklichkeit etablieren, dann - so meine These - würden sich eben auch hier immer mal wieder solche Ausnahmeerscheinungen ergeben. Ganz gemäß dem "wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer". Glauben die Player aber in der überwältigenden Mehrheit (auf einem gewissen Areal des Brettspieles), dass das hier eine "physische" Veranstaltung ist, naja, dann gibt es halt keinen oder kaum Bedarf an Außergewöhnlichem. Man will es ja glauben, was die Sekte der "Wissenschaft" einem immer wieder gebetsmühlenartig erzählt.
|
"Bei einer Messe in Stuttgart kam ich mit einem bekannten Chemiker ins Gespräch. Ich versuchte ihm zu erklären, daß wir mit dem ausgestellten System Schwermetalle bis zu einem nicht mehr meßbaren Grade reduzieren können. Es handelt sich hierbei nicht um ein Filtersystem, sondern um einen durch Informationsübertragung hervorgerufenen Effekt, der die Selbstheilungskräfte des Wassers aktiviert. Wir haben derartige informationstechnische Trinkwasserreinigungssysteme in einem durch eine Ölraffinerie verpesteten Gebiet in Ecuador installiert. Die Schwermetallbelastung des Regen- und Grundwassers durch Blei und Quecksilber war derart hoch, daß die Menschen in den umliegenden Dörfern reihenweise erkrankten. Die Wirkung des von uns installierten Systems wurde damals durch wissenschaftliche Meßreihen begleitet und bestätigt, das Resultat läßt sich aber auch in wenige Worte packen: klares Trinkwasser mit signifikanter Reduktion von Schwermetallen! Ich erinnere mich noch genau daran, wie ihn diese Erklärung zur Weißglut brachte. Was ich da sage, so der Sachverständige, könne es alles nicht geben! Ich bot ihm kurzerhand an, daß er das System mit meinen Produkten gerne bei sich im Labor testen könne.
Gleichzeitig fragte ich ihn aber auch, was er denn machen würde, wenn er am Ende tatsächlich auf dasselbe Ergebnis käme; er würde es, so sagte er, dennoch nicht glauben, denn was ich von mir geben würde, könne einfach nicht sein, da sonst die ganzen wissenschaftlichen Denkmodelle falsch wären ! Bei ihm stapelten sich die Bücher, und viele nahm er zur Hand, um mir meinen Irrtum deutlich zu machen. „Roland“, sagte er, „hier steht überall, daß das nicht sein kann, was du da machst !“
roland plocher, wenn einer weiß, was irgendwie sonst keiner weiß ...
|
So, und jetzt kommt noch etwas sehr mitreißendes, so lebhaft und anschaulich erzählt, dass man beinahe ein flaues Gefühl in der Magengegend bekommt. Und wenn nach dem Schauen des Videos bei "Darm" keine Leuchten angehen, habt ihr einen der wichtigsten, klar für ein online-Game sprechenden Punkte überhört :-)
bruce, der einzige mensch, welcher je die inneren Verletzungen von 5 Hauptblutbahnen überlebt hat. Die Operation war erst 2,5 Stunden nach dem Unfall, der Arzt meinte: "sie hätten nach 2-3 Minuten tot sein müssen" ...


|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
01.02.2025 n. Chr. 08.44 Uhr nach Sommerzeit..
"In der Nähe unseres Ferienhauses in Tisvilde wohnt ein
Mann, der hat über der Eingangstür
seines Hauses ein Hufeisen angebracht, das nach einem alten Volksglauben
Glück bringen soll.
Als ein Bekannter ihn [niels bohr] fragte: «Aber bist du denn so abergläubisch?
Glaubst du wirklich, daß das Hufeisen dir Glück bringt?», antwortete er:
«Natürlich nicht; aber man sagt doch, daß es auch dann hilft, wenn man nicht
daran glaubt.»"
werner heisenberg, Der Teil und das Ganze
Satte 12,3°C in der Bude, schon 2 Stunden wach und über alles Mögliche nachgedacht. In den Träumen, welche sich meistens im Rahmen alltäglicher Situationen bewegen, muß ich oft klar kommen mit Dingen, die ich nicht möchte, oder auch nicht erreichen kann, gerne anders hätte, naja, und so weiter, jeder kennt das ja, aus dem "richtigen" leben. Doch in letzter Zeit waren die Träume von den Gefühlen nicht mehr ganz so dolle mitnehmend, dass sie sich noch großartig in den Tag streckten. Wie nityananda sagt, es ist einfach alles "Test".
"Deal with it"
That's the Name of the Game
tom campbell
Auch noch ein wenig nachgedacht über Nag Hammadi, wo gleich am Anfang beschrieben wird, wie diese wirklichkeit zu Stande gekommen ist. Nämlich hat sich ein Äon (sophia) dieses Spiel auf eigene Faust ausgedacht, ohne gott zu fragen, und als gott dann sah, was sie ausgeheckt hatte, meinte er nur: "du hast ein Monster erschaffen, ich werde es im Auge behalten". Dieses Monster wurde Yaldabaoth, Jahwe oder auch Jehova genannt, man kann es aber auch satan, Materie, Baal, Gegenstromanlage, Bootcamp, Lern- und Entwicklungswirklichkeit, oder sonstwie nennen.
https://www.amazon.de/Nag-Hammadi-Deutsch-Studienausgabe-Berolinensis/dp/3110312344
Das hieße aber auch - sie wurde nicht geschaffen mit Einzellern, dann Fischen und Eidechsen und später Dinosauriern, sondern gleich von Anfang an mit Playern ("menschen"), als fertige Oberfläche also. Denkt an Dolly - irgendwelche Saurierknochen kann auch problemlos "nachträglich rückwärts" hier einbauen, falls die menschen beginnen, zu dolle nachzuhaken, wie denn nun hier alles erdgeschichtlich sich vollzogen hat. Im Grunde werden wir damit ganz schön zum Narren gehalten, aber klar, eine "physisch" erscheinende Virtualität benötigt natürlich auch eine "physische" Geschichte auf Kausalität beruhend, von welcher wir aber immerhin seit 100 Jahren wissen, dass es diese nicht gibt.
| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."
Heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.
|
Physische Erklärungen sind:
keine Erklärungen, sondern Verklärungen.
|
"Bei einer Messe in Stuttgart kam ich mit einem bekannten Chemiker ins Gespräch. Ich versuchte ihm zu erklären, daß wir mit dem ausgestellten System Schwermetalle bis zu einem nicht mehr meßbaren Grade reduzieren können. Es handelt sich hierbei nicht um ein Filtersystem, sondern um einen durch Informationsübertragung hervorgerufenen Effekt, der die Selbstheilungskräfte des Wassers aktiviert. Wir haben derartige informationstechnische Trinkwasserreinigungssysteme in einem durch eine Ölraffinerie verpesteten Gebiet in Ecuador installiert. Die Schwermetallbelastung des Regen- und Grundwassers durch Blei und Quecksilber war derart hoch, daß die Menschen in den umliegenden Dörfern reihenweise erkrankten. Die Wirkung des von uns installierten Systems wurde damals durch wissenschaftliche Meßreihen begleitet und bestätigt, das Resultat läßt sich aber auch in wenige Worte packen: klares Trinkwasser mit signifikanter Reduktion von Schwermetallen! Ich erinnere mich noch genau daran, wie ihn diese Erklärung zur Weißglut brachte. Was ich da sage, so der Sachverständige, könne es alles nicht geben! Ich bot ihm kurzerhand an, daß er das System mit meinen Produkten gerne bei sich im Labor testen könne.
Gleichzeitig fragte ich ihn aber auch, was er denn machen würde, wenn er am Ende tatsächlich auf dasselbe Ergebnis käme; er würde es, so sagte er, dennoch nicht glauben, denn was ich von mir geben würde, könne einfach nicht sein, da sonst die ganzen wissenschaftlichen Denkmodelle falsch wären ! Bei ihm stapelten sich die Bücher, und viele nahm er zur Hand, um mir meinen Irrtum deutlich zu machen. „Roland“, sagte er, „hier steht überall, daß das nicht sein kann, was du da machst !“
roland plocher, wenn einer weiß, was irgendwie sonst keiner weiß ...
|
"Physische" Erklärungen also sämtlich beruhen auf etwas, was es so als solches nicht gibt, somit also bestenfalls in den Bereich der Zauberei gehören, unbeschadet, dass die Wissenschaft viel zu Tage gefördert hat. Das hat sie aber nicht, weil sie "physische Gesetze" entdeckt und genutzt hat, sondern Regelwerke dieses multi player online games. Auch ein multi Player Game hat nämlich Regeln, und nicht gerade wenige.

So hat sich tom campbell etwas zu den Pyramiden von Gizeh dahingehend geäußert, dass er davon ausgeht, dass sie schlicht hinein programmiert wurden, also irgendwann einfach "da" waren.
Wir wissen, dass die "Evolutionstheorie" von darwin bloß eine Theorie war, welche sich niemals bewahrheitet hat, und heute hinlänglich widerlegt ist, also nachwievor es überhaupt keine Erklärung gibt, wie denn nun die lebewesen, inklusive des menschen, hier nun zu Stande gekommen sind. Da alle "Erklärung" sich seit 100 Jahren fälschlich sich noch immer als "physische" Erklärung versteht, brauchen wir so lange auch keiner "Erklärung" mehr unsere Aufmerksamkeit schenken, solange sie dieses Dogma von "Kausalität" nicht überwunden hat. Was wohl aber noch eine Zeit dauern wird. Und das hatte ich auch schonmal geschrieben, ich könnte mir denken, dass der jüdische Kalender stimmt, und das ganze Spiel hier nicht älter, als ungefähr 5800 Jahre ist.
Machbar ist das problemlos, für mich auch problemlos denkbar.

"Im Finale voller Kurositäten kommt der durch die Liebe auf den
1. Blick zu einer zahnspangentragenden mädchenhaften Blondine (!) umgekehrte
Beißer dann auch noch Erzfeind James Bond zuhilfe. Dümmer geht’s wirklich
nimmer!"
http://dieacademy.de/2013/01/26/50-jahre-james-bond-alle-filme-alle-darsteller-teil-2/
"Aus den Trümmern hilft ihm eine winzige blonde Frau mit Zöpfen, Dirndl,
Zahnspange und sehr dicken Brillengläsern, und so breit hat sein Stahlgebiss
noch nie gegrinst: Liebe auf den ersten Blick."
[link
to www.sueddeutsche.de]
"nachdem dieser in Rio seine winzigkleine, blonde, Zöpfchen, Nickelbrille und
Zahnspange tragende Liebe namens Dolly trifft."
[link
to www.sdb-film.de]
"Dagegen empfindet man die Liebesgeschichte des “Beißers“ mit einer
Zahnspange tragenden mädchenhafte Blondine eher als absurden Gag."
[link
to www.moviesection.de]
"Die Romanze mit ihm und dem kleinen Mädchen mit Zahnspange war recht
komisch."
[link
to www.uncut.at (secure)]
"Ich hab mich auch sehr amüsiert als er sich in diese kleine Frau mit der Dicken
Brille und Zahnspange verliebt hat."
[link
to www.jamesbond.de]
"als der Beißer zu den Guten wechselte, weil er sich in eine Art Pippi
Langstrumpf mit Zahnspange verguckt hatte."
-------
Das kleine Mädchen mit der Zahnspange, das wie Pippi
Langstrumpf aussah.
Darauf gründete sich dann auch ein Werbespot später für eine Mini-Kreditkarte,
mit dem riesenhaften Schauspieler.
Die Verkäuferin lächelt, ein Liebeslied wird gespielt.
https://www.youtube.com/watch?v=2BhLAWP7jGA
... man sieht die Zahnspange.
Im Prinzip also weiß keiner nix genaues, und letztlich ist es auch völlig unerheblich, wann es mit dieser ("Yaldabaoth") Virtualität begann. Wir sollten froh sein, dass sich sophia diese ausgedacht hat, und der Erfolg gibt ihr recht, über mangelnde Teilnehmer kann man sich nicht beschweren. Oder noch nicht.

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
03.02.2025 n. Chr. 08.53 Uhr nach Sommerzeit.
Erträgliche 10,1°C in der Bude, garnicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass es in der Nacht um die -6°c war, aktuell sind es noch immer -5°C. Rechtzeitig zum Sonnenaufgang hochgekommen, kein hohes Flugaufkommen, Regen ist ja auch nicht in Sicht die nächsten Tage
Heute habe ich auch wieder ein "incoming", brauche deswegen auch nicht soviel zu tippen, doch schaun mer ma. Noch immer schwirrt die Aussage ramana Maharshis bei mir im virtuellen Kopf herum, dass einfach alles, aber auch jede kleinste Kleinigkeit im leben eines menschen vorher bestimmt ist. Im Gegensatz zu vielen hab' ich damit überhaupt keine Probleme, bis eben auf die Frage, wie ich mir das "technisch" vorstellen soll, respektive, was damit sich alles ! rückwärts an Implikationen ergibt. Was man jedenfalls schonmal sagen kann, in formaler Hinsicht ist es natürlich zu 100% richtig, und auch völlig klar, dass es hier nicht einmal die geringste Bewegung auch nur eines Blattes am Baume gibt, welche nicht vom "System" gerendert ist, insofern natürlich auch selbst die kleinste Bewegung eines menschen, tieres nicht direkt von ihm stammt, da ja hier sich nur die Projektion des Eigentlichen vollzieht. Wenn man den Joystick in der Hand World of Warcraft spielt, ist da ja auch keiun direkter Faden, der die Figur auf der Mattscheibe wie eine Marionette bedient, sondern der jeweilige Wert des Joysticks (Position/Input) geht erstmal in den Rechner, dann durch das gesamte Regelwerk, und dann erst wird nasch Abgleich von Allem der letzte, aktuelle Zwischenstand auf die Mattscheibe projiziert.
"Hier" ist ja nicht das primäre Geschehen, "hier" ist nicht, was aus sich selbst heraus geschieht. Alles echte, eigentliche Geschehen spielt sich im Primären ab, als was auch immer man dieses Primäre näher bezeichnen möchte.

Wie viele Dinge wollen wir, die dann aber nicht eintreten ? Man will 30 Klimmzüge machen, schafft aber nur 4, will Eiscreme, eine Prüfung bestehen, Lokomotivführer werden, was weiß ich. Beileibe wird nicht immer gewährt und gerendert, was wir wollen, oder denken zu wollen. Also formal ist es schonmal klar, dass wir es nicht direkt sind, welche auch nur die Hand heben, um über die Augenbrauen zu streichen, aber das folgt halt ganz natürlich aus dem informationsbedingtem Aufbau dieser wirklichkeit, eine Instanz - tom nennt diese "rendering Engine" - muß für auch jedes kleinste Detail sorgen, welches hier auf der Mattscheibe sich als geschehen abbildet.
Aber ! es herrscht ja auch, was das Materiale betrifft, also den Inhalt, was man so durchmacht hier, ja bereits relativ große Übereinstimmung, dass für den menschen relativ einschneidende Erfahrungen keineswegs zufällig, sonder vorher ausgehandelt sind. Dieser Umstand ist in der "spirituellen Community" weitestgehend akzeptiert, auch die NDEs weisen darauf hin. Doch es scheint so, dass ein Tenor herrscht, wie "wenn ich schon die großen Weichen im leben nicht unter meiner Kontrolle habe, möchte ich diese wenigstens im Kleinen habe". Doch vielleicht "vergisst" man hier, dass man Alles unter Kontrolle hat(te), da man selbst es ja war, welche diesen Lebensfilm ausgehandelt, zusammen gestellt und schließlich zugestimmt hat. Und nun spult er sich halt ab, und man erlebt ihn als live (als ausgedehnt in Raum, Zeit, Materie etc.).
Das passt doch eigentlich recht gut, diese wirklichkeit ist ja ohnehin eine "als ob" wirklichkeit. Es scheint ja so, als wäre die Sonne die Ursache des Tageslichtes und der Wärme.

Es scheint so, als sähen wir mit den Augen, hörten mit den Ohren, griffen mit den Händen, und so weiter, doch alles das muss Illusion sein, da die Entscheidung, was hier gerendert wird, nicht hier gefällt wird, sondern "in other" (edward fredkin).
Selbst ein Experiment wie oben, mit recht großen Molekülen, kann diese wirklichkeit nicht zwingen, sich dann doch bitte auch wie ein Molekül zu verhalten, und die Eigenschaften einer gedachten "Materie" anzunehmen. nein, im Regelsatz steht, dass es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung gibt, diskret (daher die Balken und die "Leere" dazwischen), wenn keine "which way" Daten erhoben werden und davon wird auch nicht abgewichen. Daher tom auch immer sagt, dass man das genauso gut mit Toastern oder Zementlastern machen könnte - es käme dasselbe Ergebnis heraus. Materie ist nicht "Materie", sondern wirkt nur so, als ob. Und dem gemäß:
ist wirklichkeit also auch nicht hier "gerendert", sondern "woanders" ("in other", edward fredkin)
Australian national University, 27 mai 2015:
The bizarre nature of reality as laid out by quantum theory has survived another test, with scientists performing a famous experiment and proving that reality does not exist until it is measured.
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
https://health.anu.edu.au/news-events/news/experiment-confirms-quantum-theory-weirdness
Das materielle Dogma also auch wohl bei den "Spirituellen" viel
tiefer verhaftet ist, als dié meisten zugeben mögen, oder können. Denn so lange
man noch in dem Glauben ist, dass "hier" überhaupt irgendwas wirklich geschieht,
ist man nach wie vor im materiellen Dogma gefangen, und auch letztlich noch
immer Materialist.
Je mehr man aber zu der Einsicht gelangt, dass "hier" noch nie etwas geschehen
ist, noch je "geschehen" kann, weil wirklichkeit faktisch nicht hier Statt
findet, werden die Aussagen von ramana maharshi schon weitaus verdaulicher.
Und jetzt

Was ich hier jetzt das erste Mal heraus gehört habe, ram dass war auch mit swami muktananda auf einer "World Tour", also gut bekannt, doch swami muktananda ist wiederum der Schüler von nityananda !

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
04.02.2025 n. Chr. 09.21 Uhr nach Sommerzeit.
»Die Welt ist meine Vorstellung« – ist, gleich den Axiomen Euklids, ein Satz, den Jeder als wahr erkennen muß, sobald er ihn versteht; wenn gleich nicht ein solcher, den Jeder versteht, sobald er ihn hört.
Diesen Satz zum Bewußtseyn gebracht und an ihn das Problem vom Verhältniß des Idealen zum Realen, d.h. der Welt im Kopf zur Welt außer dem Kopf, geknüpft zu haben, macht, neben dem Problem von der moralischen Freiheit, den auszeichnenden Charakter der Philosophie der Neueren aus. Denn erst nachdem man sich Jahrtausende lang im bloß objektiven Philosophiren versucht hatte, entdeckte man, daß unter dem Vielen, was die Welt so räthselhaft und bedenklich macht, das Nächste und Erste Dieses ist, daß, so unermeßlich und massiv sie auch seyn mag, ihr Daseyn dennoch an einem einzigen Fädchen hängt: und dieses ist das jedesmalige Bewußtseyn, in welchem sie dasteht.
Diese Bedingung, mit welcher das Daseyn der Welt unwiderruflich behaftet ist, drückt ihr, trotz aller empirischen Realität, den Stämpel der Idealität und somit der bloßen Erscheinung auf; wodurch sie, wenigstens von Einer Seite, als dem Traume verwandt, ja als in die selbe Klasse mit ihm zu setzen, erkannt werden muß.
arthur schopenhauer, WaW Band 2, Kapitel 1, zur idealistischen Grundansicht
Den Sonnenaufgang knapp verpasst, entspannte 10,6°C in der Bude, sehr aushaltbar, grad natürlich, wenn die virtuelle Sonne ballet, welche uns anzeigt, dass jetzt der Regelsatz "Helligkeit und Wärme" aktiv ist, und grad knapp über dem Horizont steht. Jeder, welcher glaubt, die Sonne selbst sei die Ursache von Helligkeit und Wärme, kann im Grunde seines logischen/wissenschaftlichen Unwissens, respektive Unvermögens geziehen werden.

Das dachte ich mir gestern abend noch, dass ich nochmal Bezug nehmen sollte auf das "one by one" Experiment von thomas juffmann an der UNI Wien, mit dem Phtalocyanin-Molekül. Kann man auch kaufen, scheint auf den ersten, sowie auch noch zweiten und dritten Blick ausgewachsene "Materie" zu sein ...
Denn wir sind wie Baumstämme im Schnee. Scheinbar liegen sie glatt auf, und mit kleinem Anstoß sollte man sie wegschieben können. Nein, das kann man nicht, denn sie sind fest mit dem Boden verbunden. Aber sieh, sogar das ist nur scheinbar.
franz kafka, die Bäume
Die scheinbare, hartnäckig scheinbare "Materie", respektive das
Primäre dahinter, verhält aber nur so lange als ob es Materie sei,
solange Daten erhoben werden, gemessen wird. Gibt es kein Messen, keinen Vorgang
einer Datenerhebung, fällt ein wenig der Deckmantel des Materiellen, und ein
wenig zeigt sich das Primäre, Eigentliche, es ist ein mathematisch-statistisches
"Etwas", welches unseren angeniommenen Attributen von "Materie", wie "Masse" und
" Trägheit" einfach nur Hohn spricht. Und all die Unvermögenden oder Unwissenden
zerbrechen sich dann den Kopf, wie das von ihnen gesehen UFO rechtwinklig
abbiegen kann (es muß doch was "wiegen", tonnenschwer sein ...)
Was wiegt dieser LKW etwa ?
"Das Doppelspaltexperiment könnte man auch genau so gut mit
Toastern oder Zementlastern machen,
es käme dasselbe Ergebnis heraus" [Diffraktionsmuster]
tom campbell
Übrigens kann man auch hier (wie beim ANU-Physics-Experiment) davon ausgehen, dass das Phttalocyanin-Molekül keinen Weg vom Emitter zum Detektor vollzogen hat (gemessen wurde ja nicht), also man geht zwar davon aus, dass der Emitter das Molekül "herausschießt", doch die Annahme reicht. Was faktisch geschieht - auf dem Detektor wird ein "Auftreffen" simuliert, und am Emitter sehr wahrscheinlich (in unserem Verständnis rückwirkend) ein Molekül aus dem "Vorratsbehälter" abgezogen. Es gab aber nie einen Weg, welche es beschritten, oder "durchflogen" hätte.
Der Regelsatz also lautet:
Wenn am Detektor ein Molekül simuliert wird
Dann ! am Behälter eines Abziehen
Also genau entgegen unserem üblichen Verständnis, nach welchem sich ein
"Teilchen" bewegt hat vom Emitter zum Detektor.
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence"
Prof. tuscott, ANU Physics
"Materie" ist also erst dann Materie, wenn sie so erscheinen "soll", als ob sie Materie sei. Das ist aber bloß die sozusagen angenommene Form, sowie sich daten hier jetzt für euch auf dem Bildschirm als Buchstaben zeigen. Man wir im Rechner jedoch keinen einzigen Buchstaben finden können, ebenso wenig die Sonne, die Helligkeit oder sonstwas. Es ist letztlich alles dasselbe universale "Zeugs": information. Und diese sich dann ausformt zu "Auto", "Haus", "Strasse", "Baum", Sonne", "Helligkeit" und "Wärme" ,,,

So hatte das einstein dann am Ende auch zugeben müssen:
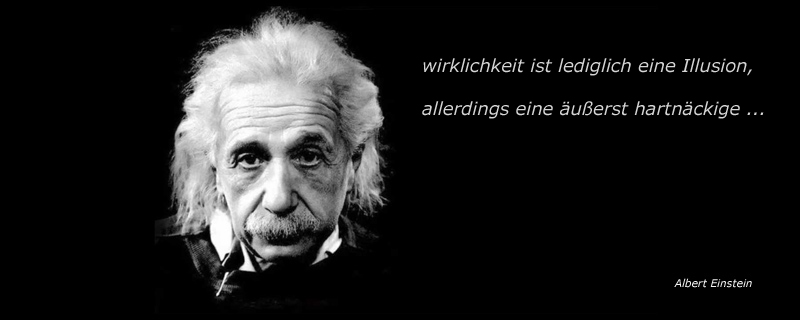
Die scheinbare Solidität und Trägheit von Allem ist eine vollkommene Illusion. Das hat übrigends als Idee der Film "Matrix" gut und anschaulöich herüber gebracht, auch wenn dieser dann den Zuschauer 180° in die falsche Richtung entführt (100% Gegenstrom), denn im Film ja das Eigentliche, das Echte dann nur wieder die materielle "Welt" ist. Aber wie es heißt, "pickt euch das Gute heraus, und den Rest werft in's Feuer". Und ja, es zeugt von besonderem Unverstand - angesichts der erschlagenden Implikationen der Experimente - dass man noch immer vermeint, die Sonne sei die Ursache des Tageslicht, während sie doch bloß für die Plausibilität von Helligkeit und Wärme hier eingebettet wurde.
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence"
Prof. tuscott, ANU Physics
Möchte man es schonend formulieren, könnte man einfach sagen, dass es von Unwissenheit zeugt, dass man die Sonne für die Ursache der Helligkeit und Wärme hält. Zuden man ja auch somit noch davon ausgeht, dass es Kausalität faktisch "gibt" welche Annahme nun auch schon lange überholt ist.
| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."
Heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.
|
Bei genauer, logischer und tiefer Analyse gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese wirklichkeit materiell, faktisch "echt" und primär ist (an sich selbst seiend). Das hat plato schon herausgearbeitet, später dann wurde diese idealistische Grundansicht weiter ausgebaut, im Wesentlichen von kant und schopenhauer.
| "ich glaube, ein wichtiger Punkt, warum in Deutschland unsere Bücher so populär sind, liegt darin, dass sich unsere Diskussionen dem Idealismus nähern, beziehungsweise, dass wir uns analytisch, metaphysisch, objektiv und ontologisch mit einigen der reichsten Traditionen des deutschen Idealismus treffen, mit schopenhauer und anderen brillanten Denkern, die an dieser wahrheit dran waren. Ein Großteil ihrer Arbeit tritt mit dieser wissenschaftlichen Revolution in ein neues Licht ..."
eben alexander
|
Warum wird es hell ?

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
25.02.2025 n. Chr. 08.37 Uhr nach Sommerzeit.
Sommerliche 13,6°C in der Bude, ich dachte eigentlich, dass es viel später ist, aber man täuscht sich dann doch, da man nicht so richtig mitbekommt, wie schnell es nun morgens mit jedem Tag früher hell wird. Soviel geträumt, dass ich ein wenig geschafft bin, es ging im letzten Traum viel um Modellbau, eine Ausstellung - und viele viele menschen, auch Bekannte und Freunde, die da waren, man Smalltalk hielt und an der Geselligkeit einfach Teil nahm. Doch viele menschen "schaffen" mich halt immer ...
Da passt es jedoch, dass ich heute etwas Kurzweiliges hab, was
luca mit geschickt hat. Interessanter Weise brauch der vom Sozialismus
infizierte immer noch irgendwelche sozialistisch autorisierte "Figuren" mit
einem gewissen Bekanntheitsgrad, um etwas Glauben zu finden, doch
nichtsdestotrotz, auch wenn es nur ein Schauspieler ist, ist es immerhin eine
Erfahrung aus erster Hand, etwas Faktisches, was man "abheften" kann. Den hier
jetzt die Hauptrolle spielenden john chang hatte ich etwa 2013 bereits öfter
vorgestellt, mit genau der Doku aus "Ring of Fiire", welche auch in folgendem
Video heran gezogen wird. Für mich bestand auch damals, selbst vor dem
DSE kein Zweifel an der Echtheit
des dort Demonstrierten, weil mir ja seit der Jugend klar war, dass diese
wirklichkeit völlig anders beschaffen ist, als sie uns erscheint. Von
daher es nichts gibt, was ich nicht für möglich halte.
Aber klar, wer nun 100% oder nahe dran ein Kind des Sozialismus ist, bei
demjenigen ist natürlich noch das Primat der Materie fest im virtuellen Kopf
verankert, nebstdem die Urteilskraft nur rudimentär ausgebildet, daher er nicht
in der Lage ist, eigene Urteile zu fällen, sondern immer schielt, was die
Majorität sagt. Doch langer Rede kurzer Sinn, hier was Schauspieler mel gibson
sagt, welcher john chang besucht hat.
Die Kommentare sind eine wahre Fundgrube, voll mit Empirie angefüllt, was so alles im täglichen und nicht so alltäglichen leben geschehen kann.
"I had a ukranian gf back at university (2004). she got a lump on her breast. In summer I went to ukraine to meet her parents. My gf, her mum and me went to visit an old lady in apartment. My gf removed her top and the lady asked me to feel the lump which I did. She then rubbed it herself for 30 seconds or so. The lump had disappeared. I couldn't believe it. She said her grandmother taught her how to heal people. Many people had gone to her and she cured them including cancer. We as spirits are so much more powerful than we know - we have simply forgotten how to use/ exert our power in our physical bodies."
----------------------------
I've heard stories such as this one and had a neighbor who
practiced something in line with what's explained in this video. I'd witnessed
him meditating most mornings, always outside, no matter the weather. I was
caught off guard one morning when I'd seen him out in the snow wearing only a
light pair of linen pants and a t-shirt... there was no snow covering him, and
about a one foot perimeter around him where the snow was melted. Anything beyond
that one foot diameter there fell about 3-4" of snow!
He taught me a bit about meditation, controlling certain aspects of my life to
better control my mind and body. I'd learned to increase my bodies temperature
like I'd observed him do on cold winter nights, and at times, I'm still able to
do so (especially when my s.o. hits me w/cold hands and feet in bed)! I'd
learned to ignore pain to a certain degree (i.e., bad migraines or bruised ribs),
but I was not always successful in doing so, although achieving a higher pain
tolerance regularly with arthritic joint pain or when I stub my toe.
He was a great neighbor, and I'll always be grateful for what he taught me."
---------------------------------
So hatte ich mich hinsichtlich des "Qi" oder "Chi" neben den vielen Möglichkeiten von Heilung und Selbstbeherrschung auch um die "Kampfkunst" gekümmert (siehe oben, der dritte Kommentar), und hatte auch dort keine Zweifel an der Echtheit. Warum auch, wenn man ohnehin von einer nicht materiellen, nicht sozialistischen wirklichkeit ausgeht, in welcher letztlich alles, aber auch alles möglich ist.
Daher hier für dieses "Genre" Lama dorje dondrup (dr. yeung) mit einer sehr eloquenten Erklärung (incl. Demonstration), was hier vor sich geht. Er geht tatsächlich auch schon ein wenig vom "Physischen" ab, und verlegt diese in Richtung des Geistigen, Spirituellen.
"Its about Healing, it's about understanding the Nature of Things"
lama dorje dondrup
"Its about Healing, it's about understanding the Nature of Things"
lama dorje dondrup
So folge ich allerdings nicht einer einzigen "physischen Erklärung", weil es hier "physisch" schlichtweg überhaupt garnichts zu erklären gibt, da diese wirklichkeit nicht auf irgendwelchen "Teilchen" oder "Wellen" oder "Energie" und ähnlichem BS beruht, sondern auf information, respektive Daten. Daher, was dort geschieht, wie diese menschen diese "Fähigkeiten" erlangen, auf völlig anderen Prinzipien, vergleichbar denen eines Videogames, beruhen muss. Also Ausdauer, Hartnäckigkeit, "Dedikation", also wie sehr man sich dem Spiel widmet, hingibt, und so weiter. Da kommen dann Punktestände in's Spiel, Verteilungen auf die diversen Spielerkonten, der ausgesuchte lebenslauf ("plan") und so weiter. Wie gesagt, wer mit "physischen" "Erklärungen" es versucht, hat noch nullkommanull von der Natur dieser wirklichkeit kapiert.
Faktisch "physisch" und damit "physisch" erklärbar ist haargenau:
garnichts
Wer will, kann sich eine Menge der Qi oder Chi (-gong) "Kampfkunst" anschauen, da passieren halt die "physisch" unmöglichsten Dinge, aber hey, da nichts "physisch" ist - warum sollen die denn nicht passieren ? Denn hier ist letztlich alles möglich, selbst das, was man sich nicht einmal vorstellen kann.

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
01.03.2025 n. Chr. 08.41 Uhr nach Sommerzeit.
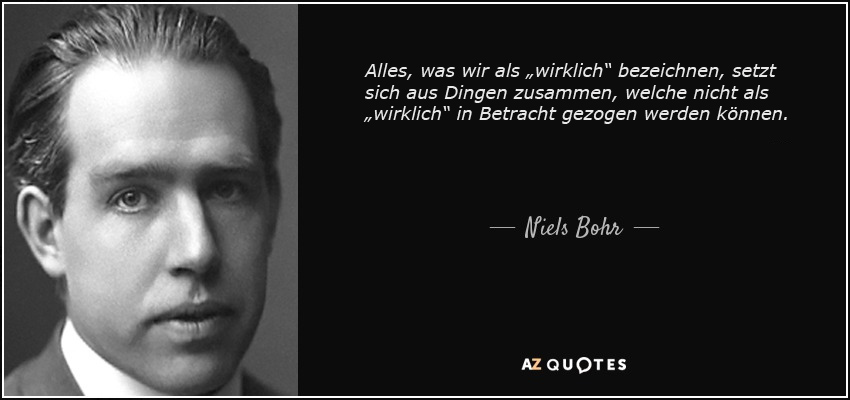
Hier sind wir an dem fundamentalsten Punkt überhaupt, den wir auf logisch-empirischen Wege erreichen können, wenn es um die Grundfesten dieser (scheinbaren) wirklichkeit geht. Für mich ist das immer wieder ein Rückzugspunkt, auf welchen ich mich besinne, wenn ich das Gefühl bekomme, mich (in Komplexität) zu verrennen.
Dos moi pou stō, kai tēn gēn kinēsō
Gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann, und ich bewege die Erde
archimedes
Wenn immer sich alles in Relativität zu verlieren droht, komme ich immer wieder zurück darauf, dass diese uns allen vorliegende wirklichkeit nur scheinbar hier Statt findet, sämtliche wirklichkeit, wie wir sie so erleben, ein Trug ist, eine Illusion. Wie gesagt, das können wir auf logischem und empirischem Wege - mit etwas Hartnäckigkeit - herausfinden (Doppelspaltexperiment, delayed Quantum Choice Eraser etc.). Haben wir diesen Punkt erreicht, können wir sagen:
Alle physische Erscheinung ist Illusion, da sekundär.
somit
alle "physikalischen" "Gesetze" nur Scheingesetze sind.
Und das unbeschadet, dass diese "physikalischen" Scheingesetze doch gut anwendbar sind. Aber so ist es ja in einem online-Konstruktionsspiel für angehende Ingeneure ebenso, sie haben ihre Materialen, geometrische Eigenschaften, und können in diesem Game auch versuchen, die dollsten Brücken zu bauen, und je nach Regelsatz, und wie gut sie sich diese hinein gearbeitet haben, hält die Brücke, oder eben auch nicht. Nur deswegen gibt es natürlich im Konstruktionsgame selber keine "Gesetze", denn
das Spiel findet ja nicht auf dem Monitor statt.
Sondern "in other", also "nicht hier" (edward fredkin Vater der digitalen Physik).
Das ist also mein Rückzugspunkt zur Re-Orientierung, wenn immer mir die Dinge über den Kopf wachsen, auszuufern, oder schwammig zu werden drohen, und man dann sozusagen wieder klar wird:
alles ist vollkommene Illusion (Maya)
Dabei garnicht in Abrede gestellt wird, dass die Illusion eine Bedeutung hat, oder haben könnte, insofern auch nicht sinnlos ist, sondern man nur erstmal vom Formalen her festhält, dass diese ganze "Welt" in all ihrer Buntscheckigkeit nicht in und an sich selbst Bestand hat, selbst also von etwas völlig anderem, primärem abhängig sein muß.
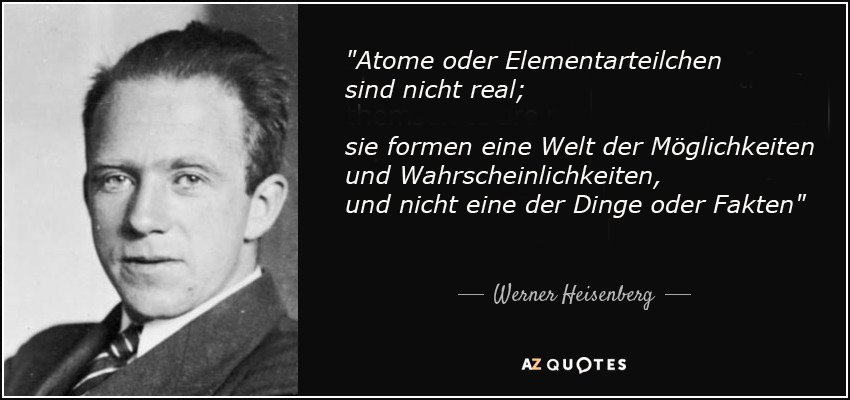
Immerhin, die Pixelgrüße und "Prozessorgeschwindigkeit", also das kleinste Zeitintervall dieser Scheinwirklichkeit sind schon vor etwa hundert Jahren herausgefunden worden.
planck Zeit (Zeitintervall): 5,391 · 10 −44 Sekunden
planck-länge (Pixelgröße): 1,616 · 10−35 Meter
Wir erfahren im Grunde in jeglicher Hinsicht Bestätigung von Seiten noch echter Wissenschaft, dass diese uns vorliegende wirklichkeit ein sekundäres, abgeleitetes Phänomen ist, und demgemäß alles das, was wir "physikalische Gesetze" nennen, etwas sein muß, was am "Ort" des Primären, wie immer wir das definieren wollen, so festgelegt wurde (Regelsatz, tom campbell). Die Gesetzmäßigkeiten, wie ein Pfeil bei World of Warcraft fliegt, sind nunmal nicht im oder auf dem Monitor zu finden.
Denn: im Sinne von "Geben" - gibt es den Pfeil nicht.
Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.
franz kafka, der Aufbruch

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
02.03.2025 n. Chr. 08.09 Uhr nach Sommerzeit.
Das Einfache ist das Kennzeichen des Wahren
Ja, wie ich gestern schrub, von der formalen Seite her lässt sich diese wirklichkeit relativ schnell auf ein Wort eindampfen, kondensieren. Sie ist: Illusion. Was nicht meint, dass sie keine Bedeutung hat. Da sind wir bereits im Materialen, im Inhaltlichen. Doch allein an dem grundlegenden (formalen) Aufbau von wirklichkeit lässt sich ja so einiges am Implikationen ableiten, im Wesentlichen natürlich, dass wir von etwas Echtem, Wahrem ausgehen müssen, welches hinter all dem buntscheckigem, scheinbaren Treiben hier steckt.
Noch zahlreiche weitere Implikationen schließen sich an den Umstand an, dass diese, uns allen vorliegende wirklichkeit ein sekundäres, abgeleitetes Phänomen ist, und faktisch "woanders" in wirklichkeit Statt findet - doch davon habe ich ja bereits oft genug geschrieben. Für jetzt und in aller Kürze will ich nur nochmal Bezug nehmen auf das Gestrige, nämlich, wenn immer ich mich zu verheddern oder Vorstellungen auszuufern drohen, dann erinnere ich mich selber wieder an diesen einen Ausgangspunkt, dieses
dos moi pou stō
des archimedes (gebe mir einen Punkt, auf welchem ich stehen kann). Dahin zu gelangen, auf logisch-empirischen und echt ! wissenschaftlichem Wege, war zwar nicht mal eben so gemacht, und ein doch recht langer Weg, welcher hartnäckig begangen werden wollte, doch hat sich am Ende mehr als gelohnt. Der Verstand, der Intellekt hat sich in gewissem Sinne selbst überlistet. Wohl eigentlich dafür geschaffen, dieses Ganze hier Ernst und physische zu nehmen, grad auch über die Sinne, ist er in einem gewissen Sinne über das Ziel hinaus geschossen, und hat dieses Ganze, was ja so ernst genommen werden sollte, wollte, dann letztlich entlarvt, als das, was es faktisch (formal) ist: eine Illusion (Maya).
Auf objektivem Wege dorthin zu gelangen, also mitteilbar (also teilbar) ist etwas völlig anderes, als das man es "fühlt" oder auch sogar demonstriert bekommen hat (z.B. NDE, oder wie bei mir der ruckelnde Mond). Sowas sind subjektive Geschichten, auf welche man nicht hinweisen kann mit einem "überzeuge dich doch doch selbst", wie man es bei einem DSE oder auch DQCEE kann.

So empfinde ich das als eine Art "Königsweg", denn man ist halt nicht auf irgendwelche subjektiven Glaubensgeschichten angewiesen, welche zwar wahr sein können, aber nicht müssen, sondern kann sagen: "hier, hier isses, kümmer' dich selbst". Dann es der Hartnäckigkeit des Einzelnen unterliegt, ob er sich mit solch erst einmal trockenen Materie befassen möchte, kann - oder eben auch nicht. Jedenfalls die großen geister, welche sich von Berufs wegen schon damit befassen mussten - unisono zu ein und demselben Ergebnis gelangten.
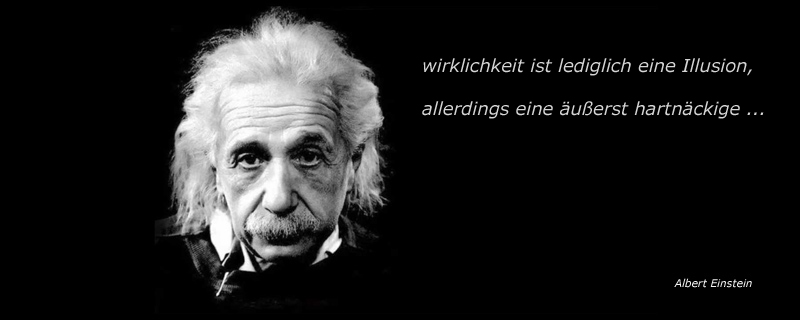
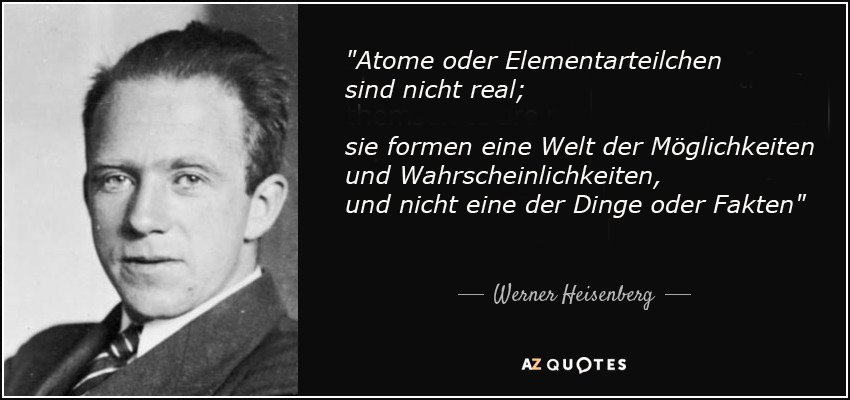
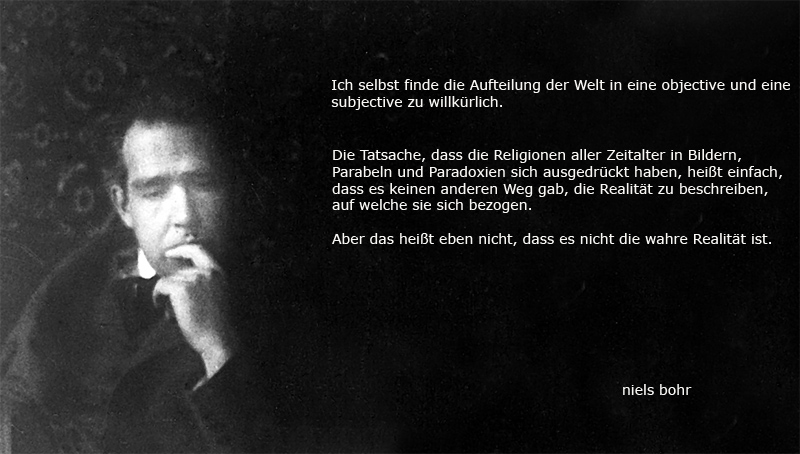
Klar - diese noch echten Wissenschaftler mussten sich von Berufs wegen ja auseinandersetzen mit den Implikationen etwa eines Doppelspaltexperimentes oder auch dem delayed Quantum Choice Eraser Experiment, welche ja (insbesondere letzteres) die illusionäre und abgeleitete natur dieser wirklichkeit offenbaren. Nicht umsonst wird das DQCEE genannt:
der letzte Sargnagel für den Materialismus.
Dann war es allerdings nochmals ein ganzes Stück Arbeit, dann etwa dazu zu
kommen, dass jegliche "physische" "Erklärung" von auch nur irgendwas, letztlich
sein muß: falsch. Und zwar jegliche. Doch schließlich ergibt sich das ganz
konsequent aus der sekundären, abgeleiteten natur dieser wirklichkeit, welche ja
hier stattfindet: nicht.
"Den Stoß verdeckter Spielkarten gibt es gar nicht. In jedem Augenblick wird eine leere Karte neu gemalt. Die zukünftige Welt ist ein Gesamtkunstwerk, wo alles jetzt Bestehende mitmalt, aber mit unterschiedlichem Einfluss. In der Physik sprechen wir von Erwartungsfeldern, deren Überlagerung die zukünftigen Möglichkeiten einer Realisierung vorbereitet mit recht unterschiedlichen Auswirkungen."
hans-peter duerr, ehem. Leiter des max planck
Institutes
Und ich glaube, dass sich - ausgehend nur von der Gewissheit, dass wirklichkeit formal betrachtet eine Art Illusion oder Traum ist - sich noch einige einfache Wahrheiten oder zumindest doch hohe Wahrscheinlichkeiten ent- oder auswickeln lassen, welche das Materiale, das Inhaltliche angehen. Und es deucht mich, dass das wesentliche Material, also worum es hier geht, in der Tat so einfach sein könnte, wie es maharaj ji stets formuliert hatte
feed the people
help the peopler
love all people and tell the Truth
Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.
franz kafka, der Aufbruch
lahiri mahasaya
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
11.03.2025 n. Chr. 08.26 Uhr nach Sommerzeit.
Alles, was unsere Sinne uns sagen, unsere Worte
formulieren, ist Illusion.
Etwas paraphrasiert, neem karoli baba
Aus: alokik yathartha: the divine reality
Das Buch liegt jetzt leider oben bei thomas, daher ich nicht nachschauen kann ..
Boah, heute bin ich matschig, ein halbes Bier zuviel getrunken, 5 Stunden telefoniert gestern, versehentlich (wahrscheinlich) 2 anstelle von einer Melatonin-Tablette genommen, und das Handy wieder in der Hose am Kopfende des Bettes vergessen.
Wie es aussieht, ist jetzt auch für eine längere Weile wieder "drinne-Wetter", und das Sommermärchen ist vorbei. Schade, aber immerhin habe ich jeden Tag und beinahe jede Minute an der Sonne verbracht, aber gut, es ist nicht so, dass "drinne" nicht auch was zu machen wäre. Doch viel an der frischen Luft zu sein tut einfach gut, und ist stets den muffigen 4 Wänden vorzuziehen.
futur
manufaktur
makulatur
kultur
kandidatur
lineatur
kreatur
miniatur
...und so weiter
Noch habe ich mir keine Gedanken über das Suffix "tur" gemacht, also was es für die Silbe davor bedeutet, respektive mit ihr macht, doch so einige Silben habe ich ja in ihrer Bedeutung herausgefunden und unter anderem gibt es ja eine Silbe, welche bedeutet:
Schein, Anschein, Widerschein
also nicht das Echte, das Ursprüngliche, das Eigentliche, sondern etwas, was sekundär ist, abgeleitet. Ein Schein, das Scheinbare ist ja wie ein Traum nicht Nichts, sondern schon etwas, und hat auch seine Bedeutung, wie wohl auch Berechtigung, doch der Traum hat zur Grundlage also das Primäre, von welchem wir annehmen, dass es der Träumende sei, jedenfalls sicher ist, dass der Traum eines Subjektes bedarf (Bewusstheit). Wenn wir auch heute noch nicht wissen, wer oder was diesen erzeugt, noch was Traum nun seiner natur nach ist, so ist uns doch klar, dass eben so etwas ist, wie Schein, Anschein, Widerschein (von etwas Anderem, Primären, Erzeugendem). Und die Silbe dafür ist eben: na
So wird da draus: natur
Ganz elegant, einfach wird das Wesen des Ganzen gekennzeichnet, und wer sich jetzt hinein versetzt, dem wird klar, "natur" heißt dann genau dasselbe wie ? Also wirklich und wortwörtlich ?
Genau, natur ist somit expressis verbis genau das Gleiche, was die Inder
bezeichnen mit maya.
Simplex sigillum veri. Und sam hess, der ehemalige Förster, welche ja noch manch andere Begabung hat, sagte auch öfter:
Wenn du eine Baum fällst, so ist er nicht wirklich weg.
In dem, was der Baum war, ist er nach wie vor noch da.
Stellt euch das Ganze aus der Videogame-Perspektive vor, ihr macht die Bäume nieder, doch was sind denn die Bäume im Spiel. Nun, sie sind zunächst erstmal daten, in einer speziellen Anordnung (Muster), was dann für uns information darstellt, und diese information uns auf dem Bildschirm als Baum erscheint. Macht man nun im Game diesen Baum nieder, ist ja damit die eigentliche information nicht weg, nur, sie ist nicht mehr "im Spiel". An sich ist sie sehr wohl noch vorhanden.
So auch der Mond in demselben Augenblick, in welchem man ihn nicht mehr betrachtet, auch eben "nicht mehr ist" (im Spiel), er ist weg, wie der Baum. Doch deswegen ist ja die zu Grunde liegende Information nicht weg, sondern schaut man wieder hin, wird sich der Datei "Mond" wieder bedient, und der Mond erscheint. Übrigens komme ich noch nicht richtig darüber hinweg, dass mir (und franzi) damals die digitale Einrichtung von wirklichkeit ausgerechnet an dem Tag gezeigt wurde, an welchem traditionell hanuman gedacht wurde (damals 08 April 2020). Und eben wiederum neem karoli baba als Inkarnation von hanuman wiederum gilt ...
https://maharajjisevatrust.com/blogs/f/is-neem-karoli-baba-the-incarnation-of-lord-hanuman
Der ruckelnd, zuckelnd, digital (diskret) durch den Himmel sich bewegende Mond war eine ganz "normale" wirklichkeit der Wahrnehmung, wie alles andere davor und danach auch, nur eben, dass diese "Wahrnehmung" nicht in das gewohnte Bild von wirklichkeit passt, indem man ja glaubt, oder glaubte, dass Materie echt ist, und Dinge aus "Materie" sind. Doch dem ist halt nicht so, der Mond ist eben auch ein digitales "Etwas", information eben
in Form
von "Mond".
lu na
Licht Widerschein
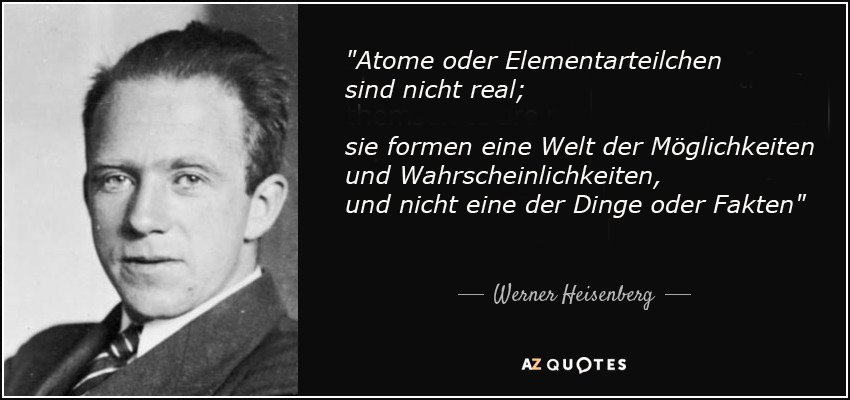
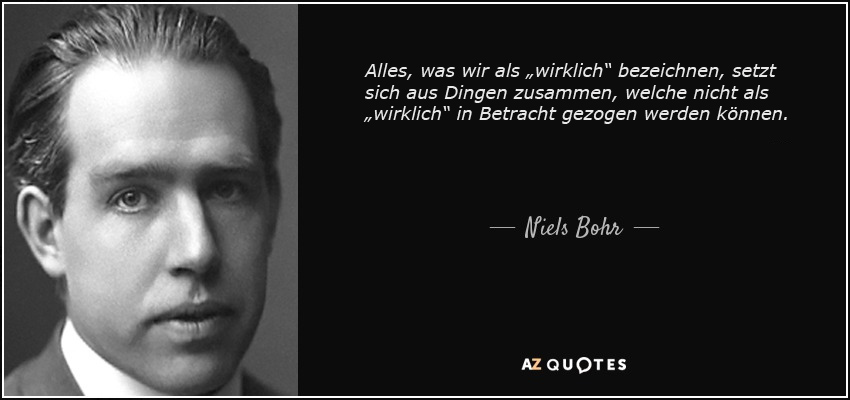
Tja, und auch hier betrügt uns die Sprache nicht, "lich" heißt ja, dass es nicht das ist, was davor steht, sondern nur irgendwie in Analogie dazu, aber nicht das Vorgenannte selbst.
kindlich ist nicht kind
gefährlich nicht Gefahr
grünlich nicht grün
wirklich
Es scheint halt so ...

na tur
wirk lich keit
maya
warum wird es hell ?
"Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise"
franz kafka, letzter Satz aus: der Aufbruch

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
13.03.2025 n. Chr. 08.16 Uhr nach Sommerzeit.

1°C draußen in der Bude noch satte 13,8°C, doch es bleibt für eine Weile kühler, also wieder "das Wohnzimmer", die Ansitzhose herausgeholt, welche für den Winter gedacht ist, und hält, was sie verspricht.
Graugraugraugrau da draußen, das wird sich wohl auch nicht mehr ändern, doch immerhin hatten wir ja schon schöne Tage, meine mutter hat es als Weisheit schon früh mitbekommen: "der März hat 9 schöne Tage", die hatten wir ja gehabt, und am Stück. Obwohl, wenn man oben schaut, es soll in ein paar Tagen wieder Sonne geben :-)
Achso, und ich sehe grad, ich habe das gestern schon gebracht, aber nachträglich verdient dieser Workshop ein ...

... denn er ist echt intensiv, und die Fragen sind auch nicht so ganz die üblichen, demgemäß die Antworten.
Sonst hab' ich gerade nicht viel zu erzählen, doch ich kann noch etwas abarbeiten, was allerdings recht schnell geht. Man sehe sich hier im Bild den recht komplexen, und wahrscheinlich auch äußerst genauen Aufbau der ganzen Linsen und Spiegel und sonstwas an. Respektive - wenn das Photo bloß gestellt ist - man überlege sich, wie genau ein Aufbau eines Experimentes sein muss, wenn bei verschiedenen möglichen Wegen die "Teilchen" oder was immer es ist, am gemeinsamen Ziel dann wieder zur gleichen Zeit ankommen sollen. Bei ~ 300.000km die Sekunde
Der Emitter ist oben links, und die "Teilchen!" nehmen entweder den oberen, oder den unteren Pfad zum Detektor.

Was man faktisch und greifbar dann schließlich in den Händen hält, ganz empirisch - sind die Daten, welche die Detektoren ausspucken. Alles andere, ob da wirklich sich etwas von oben links nach unten rechts bewegt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Nur klar, wenn wir unten rechts am Detektor, oder über den Detektor daten erhalten, dass jetzt hier, an Koordinate x soundso, y soundso etwas "geschehen" ist, dann gehen wir natürlich davon aus, dass diese Daten, dieses "Eintreffen" das Eintreffen unseres vom Emitter ausgesendeten Irgendwas ist, was auch immer es ist. Denn, wir denken - nachwievor - in Kausalität.
Doch genau die existiert nicht.
| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."
Heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.
|
Interessanterweise hat das oben von prof. tuscott vorgestellte Experiment sogar
genau Das zu Tage gefördert !
Australian national University, 27 mai 2015:
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
https://health.anu.edu.au/news-events/news/experiment-confirms-quantum-theory-weirdness
Trotz also der daten, welche man ganz empirisch erhält, hat
der "Emitter" also nie etwas faktisch auf den Weg gebracht, und NICHTS - also
weder ein "Teilchen", noch eine "Welle" - hat
"entweder einen oberen,
oder einen unteren Weg" beschritten.
Und das ist demnach der Witz an dem ganzen) und letztlich auch aller ähnlich gelagerten Experiment - peinlich genau und mit äußerstem Aufwand, präzisesten Werkzeugen, extrem teuren Apparaten, saumäßigem Hirnschmalz und hohem Zeitaufwand realisiert man ein Experiment, nur um dann am Ende fest zu stellen, dass der Emitter nie etwas gemacht hat, faktisch", noch irgendwas durch die penibelst genau positionierten Linsen oder halbdurchlässigen Spiegel gegangen ist, respektive von den normalen Spiegeln auf eine andere "Bahn" umgelenkt wurde.
Da setzt man also so viel Hirnschmalz ein, schwitzt sich den
Arsch ab vor Präzision,
investiert Tonnen von Stunden und Geld,
und am Ende wurden all die Spiegelchen und Linsen
überhaupt nicht benutzt ...
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
https://health.anu.edu.au/news-events/news/experiment-confirms-quantum-theory-weirdness
Also ich würde mir da ein wenig veräppelt vorkommen.

Und hier - eine auf 40 Minuten gekürzte deutsche Fassung, aber immerhin. Von tom erklärt - das ANU Physics Experiment
Original, mit 1h 42 Min, in Englisch: HIER

"How we live our life is our Practice"
krishna das
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
19.03.2025 n. Chr. 08.23 Uhr nach Sommerzeit.
-2°C draußen, satte 13,7°C in der Bude, und ich bin im Buch "Devine Reality" jetzt bei Erzählung 25 angekommen, von ungefähr 250, welche es in diesem Buch gibt.
Um die einzelnen Vorfälle, Geschichten nicht zu verwässern, lese ich nicht so viel, wie ich könnte, sondern nur etwa 20 Seiten, und auch nur, wenn Sonne scheint, und man draußen sitzen kann. Wenn man dann nach 20 Seiten das Buch zuklappt, aufsteht, hat man das Gefühl, einen der seltenen Momente hier erleben zu dürfen, wo man etwas klarer im "Kopf" ist, und man es ein wenig spürt: "ich befinde mich hier in einem Traum".

Etwas anderes, als das diese wirklichkeit eine Art von Traum ist, bleibt einfach nicht über.

Es ist die eine Sache, es zu wissen, aber nochmals eine ganz andere, das traumartige Moment von wirklichkeit dann auch noch spüren zu können, zumindest ein wenig. Und dieses Spüren ergibt sich nicht durch irgendwelche bio-chemischen Zusammenhänge im ohnehin nicht vorhandenen Kopf, sondern durch Freigabe, oder auch Grace, wie man es andere bezeichnen würden. Es scheint auch so zu sein, dass man nicht zwingen kann, was man erhält, in diesem Sinne es also nicht wirklich der Automatismus eines Schwellenwertprinzips ist (genug Punkte gesammelt), sondern am Ende es eine Instanz gibt, die das absolut letzte Wort hat, ob dir etwas Zu Teil wird, oder nicht. Man kann sozusagen die Möglichkeiten zur Erteilung von Gnade (Einsicht, Weisheit, Gefühl etc.) verschieben und "verbessern", doch man kann sie nicht erzwingen (durch Punkte sammeln oder Hartnäckigkeit).
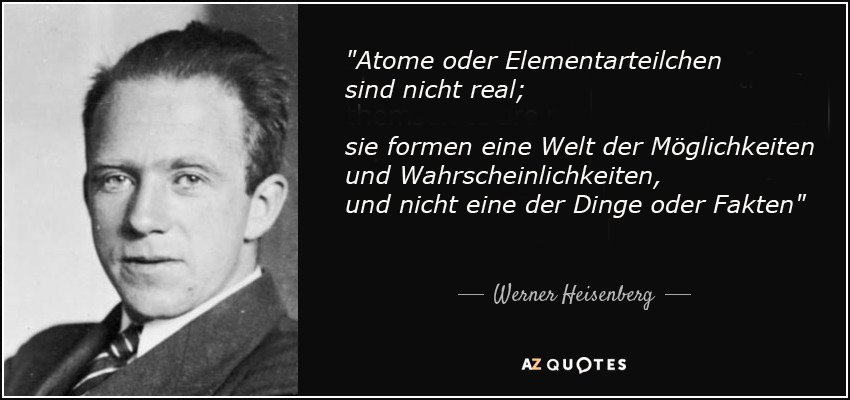
Man erhält nicht, was man will,
sondern, was man benötigt.
Allerdings dieses Gefühl, das traumartige Moment von wirklichkeit spüren zu können, nicht sehr lange anhält. Was auch seinen guten Sinn hat, denn schließlich sind wir ja hier, um hier - jeder auf seine Art und Intensität - Teil zu nehmen am Geschehen.
Die wirklichkeit, welche ein jeder erlebt,
ist ja nicht grundlos so, wie sie ist.
"Darum ist dieses dein Leben, das du lebst, auch nicht ein
Stück nur des Weltgeschehens,
sondern in einem bestimmten Sinn das ganze. Nur ist dieses Ganze nicht so
beschaffen,
daß es sich mit einem Blick überschauen läßt.
Das ist es bekanntlich, was die Brahmanen ausdrücken
mit der heiligen, mystischen
und doch eigentlich so einfachen und klaren Formel Tat twam asi (das bist du)."
erwin schroedinger, Physik und Transzendenz, hans-peter duerr (Hrsg.)
Jeder nimmt hier eben auf seine Art Teil. Mehr oder weniger eingetaucht, mehr oder weniger intensiv, mehr oder weniger reflektiert. Doch zu jedem passt eben genau die wirklichkeit, welche er gerade erlebt, "wirklichkeit ist stets perfekt", wie maharaj-ji es desöfteren man so, oder so ähnlich formulierte. "Keiner hat die wirklichkeit, die er will, aber jeder hat die, die er gerade benötigt", so könnte man es auch sagen. Und dazu gehört das scheinbar Schlechte, wie eben auch das scheinbar Gute. Die Letzten werden die Ersten sein.
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|

23.03.2025 n. Chr. 07.49 Uhr nach Sommerzeit.
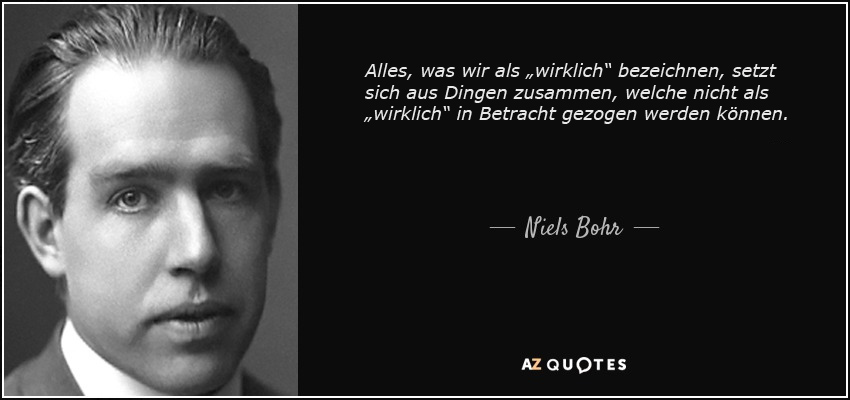
Die Anzuchterde für die Tomaten ist jetzt das erste Mal eine beliebige Erde, welche draußen in den Eimern sich fand, doch jetzt habe ich mit allem möglichen Grünzeugs "zu kämpfen", welches jeden Tag neu heraus sprießt. Doch die Keimlinge der Tomaten lassen sich recht gut identifizieren, es dürfte also keine Gefahr bestehen, dass ich die falschen herauszupfe. So war es noch letztes Jahr mit dem Hochbeet, ich hab dort jede Menge Pflanzen herausgeholt, welche ich für Unkraut hielt, nur um dann zu realisieren, dass das Feldblumen sind, welche meine Mutter liebt. Naja, ein paar sind letztes Jahr dann doch noch gekommen, aber dieses Jahr werden es einige mehr.
Ansonsten recht grau und trüb das Wetter, wie angesagt, doch mit Glück kommt heute Vormittag noch ein wenig die Sonne heraus.
Gestern dann auf einer Veranstaltung von krishna das mir einen buddhistischen Mönch angehört, also etwas von der Lehre gehört, und das waren mir schon alles zuviel Worte. Im Verlaufe schaute ich mir dann noch mehr praktisch gelebtes leben in den buddhistischen Tempeln an, doch nach so intensiver Beschäftigung mit maharaj ji stieß mir dann gleich der Formalismus sauer auf, welcher wohl einher geht mit wohl größeren spirituellen Lehre. Nun weiß ich allerdings nicht viel über den Hinduismus, aber es schien mir so, dass dort jeder so "seins" macht, es dort keinen übergreifenden Formalismus gibt, jedenfalls ist mir bis jetzt nichts weiter in dieser Richtung aufgefallen. Wo ich jetzt grad so nachdenke, fällt mir auf, dass es im Hinduismus gar keine zentrale, einheitliche Figur zu geben scheint ? Na egal, das findet sich schon im Verlaufe. Ah ... was ich mir von dem Vortrag von dem Buddhisten gemerkt habe, ist Punkt vier von den 4 Stufen der Erkenntnis dieser wirklichkeit, und davon Punkt 4, nämlich, dass dir unerschütterlich klar ist, dass diese wirklichkeit eine Art Traum ist, und auf keinen Fall das, als was sie einem erscheint.
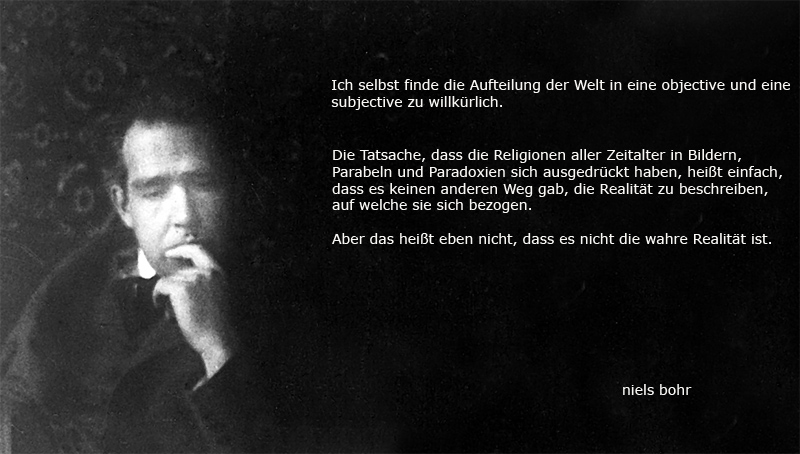
Bei dem gestrigen "Incoming" Interview sprach krishna das auch nochmal über den letzten Tag vom maharaj ji im Tempel, bevor er diese Bühne wieder verließ, und nach krishna das, welcher das wohl von siddhi ma weiß, da er ja zu diesem Zeitpunkt in den USA sich befand, frohlockte maharaj ji (zu kc tewari):
"Today i am coming out of central Jail"
"Also nich "heute werde ich aus dem Gefängnis entlassen", sondern "heute werde ich aus dem zentralen Gefängnis entlassen". Also dem großen, übergeordnetem Gefängnis. und das ist eben nicht der Planet, oder die wirklichkeit hier
sondern der Körper selbst !
Das deckt sich wunderbar mit den NDE Schilderungen, und der hier die Allermeisten beherrschenden Ansicht, wie dem scheinbar unmittelbaren Gefühl, dass der Körper nämlich "das Höchste" und "Alles" ist. Dann wäre die ganzer Geschichte genau um 180! verdreht, und letztlich vollkommenen paradox (para = gegenüber, dox = Dogma ?). Was wiederum eine gewisse, wenn nicht gar hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, dass es die Wahrheit ist, und somit beinahe an einem Stockholm-Syndrom leidet, da er dasjenige, was ihn zentral peinigt, über alles liebt.
Klar, man sollte das Kind nicht mit Bade ausschütten, alles hat eben seinen Sinn und Funktion, doch man kann wohl ein wenig nachvollziehen, dass maharaj ji nach 73 Jahren dieser Rolle überdrüssig war, und sich nun freute, dass er nun endlich von der Bühne herunter und wieder in das echte leben eintauchen kann. Ganz wie hier, man spielt das Stück seine 90 Minuten vielleicht, dann fällt der Vorhang, und nach einem kurzen Moment des Umziehens ist man zurück in der wirklichkeit (oder hier jedenfalls für "echt" bloß geglaubten wirklichkeit, indem ja alles fraktal zu sein scheint).
So wusste maharaj ji genau, wohin er nun endlich zurückkehren, nachdem er nun endlich von der Bühne wieder herunter kann - ein großer Vorteil natürlich, wenn man einfach beinahe das ganze, wenn nicht das ganze leben hindurch darum weiß, dass man sich bloß gerade auf einer Bühne, in einer Art Videospiel sich befindet. Nur wahrscheinlich ist es aber auch nur Ausnahmeerscheinungen gestattet, darum zu wissen, weil es nur ganz wenige gibt, welche überhaupt mit diesem Wissen umgehen können, respektive hier "unten" überhaupt noch in einer gewissen Normalität (des geistes) agieren können. Für uns normale Player wäre das viel zu viel, wir könnten unsere Rolle hier einfach nicht mehr spielen. Also ist es schon ganz gut so, dass glauben wir sind die und die, der und der, so nehmen wir die Rolle einfach super-ernst, und führen ein letztlich geniales Stück auf. Bis auf klaus kinski vielleicht hat noch kein Schauspieler vergessen, dass er sich gerade nur in einer Rolle befindet.
Wer das "Incoming" - Interview mit krishna das noch nicht gehört hat, nachholen ! Ein Spoiler, dort ist auch ein Bericht drin, wie maharaj ji eine Tote zum leben erweckt, auch das erste Mal, dass ich über ein "lila" dieser Art von ihm etwas hören durfte. Und wer es bereits sich angehört hat
maharaj ji zu krishna das: "frag mal den da drüben, was er
gerade macht"
krishna das fragt (hannibal) , und gibt maharaj ji zur Antwort: "er sagt, er
meditiert"
maharaj ji zu krishna das: "frag ihn mal, ob wissen möchte, wie echte Meditation
geht"
krishna das fragt, und sagt zu maharaj ji: "er sagt ja"
Tja, und dann zeigt er, wie echte Meditation aussieht. Anschließend:
maharaj ji zu hannibal: "hast du begriffen, was du gerade gesehen hast"
hannibal:"nein"
maharaj ji: "willst du es nochmal sehen ?"
hannibal: "ja"
maharaj ji ruft den die echte Meditation demonstrierenden Devotee wieder herbei, und der rollt schon die Augen, "na gut, dann eben nochmal ..."

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
24.03.2025 n. Chr. 07.47 Uhr nach Sommerzeit.
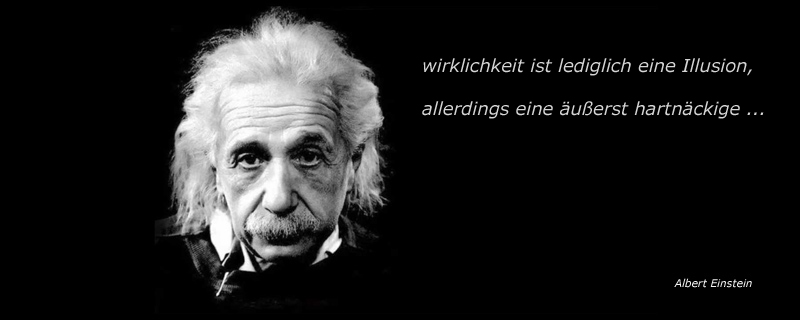
Grau "da draußen", und ohne den Sonnenstand zu sehen, ist es immer schwer abzuschätzen, wie spät es ist. Die einzige "fest installierte" Uhr hier oben ist im Rechner, da ist es dann immer irgendwie spannend, den hochzufahren, und zu sehen, wie gut oder früh man aus der Falle heraus gekommen ist.
Gleich am Anfang jetzt wird es auch schon "dolle", wir kommen der ganze Sache hier "technisch" ein wenig näher. Also, kc tewari ist mit maharaj ji in den Bergen spazieren. Ein Teil der Devotees ist in Neu Delhi, wo ein neuer Tempel eingerichtet wird, etwas 14 Autostunden entfernt. Man erwartet doch eigentlich auch maharaj ji, doch der ist halt mit kc tewari in den Bergen. Wohl angekommen, wo die beiden hin wollten, sagt maharaj ji zu kc tewari, dass er meditieren möge. Wer das gestern und vorgestern vorgeschlagene Interview mit krishna das gehört hat, der weiß jetzt auch, was Meditation bedeutet, wenn es maharaj ji sagt, nämlich: samadhi. Gut, kc tewari setzt sich halt hin, und ist auch gleich in samadhi, einem Zustand, in welchem man nicht mal mehr atmet. Nach einer Weile weckt ihn maharaj ji wieder auf: "komm, los - du verschwendest meine Zeit", und sie gehen zurück in ihren Tempel.
Am nächsten Tag trudeln einige der Devotees ein, die in Neu Delhi bei der
Einweihung dabei waren. Sie bringen Prasad mit, also Opferspeisen, welche
für die Götter, Heiligen, Babas und Gurus zubereitet werden, für lebende aber
auch nicht mehr gegenwärtige. Die Rückkehrer treffen auch auf kc tewari, und
sagen zu ihm dass sie Prasad mitgebracht haben, welches sie gestern maharaji ji
geben wollten, doch der nicht mehr gefunden werden konnte. kc tewari hakt nach:
"maharaji ji war bei der Einweihung ?", und bekommt zur Antwort: "ja, er war bei
der Einweihung, und als wir ihm Prasad bringen wollten, war er nicht mehr
aufzufinden". kc tewari, dem dieses Phänomen wohl zu dieser Zeit noch
relativ neu war, beginnt sich zu echauffieren, und sagt, dass er mit maharij ji
den ganzen Tag verbracht hat, das also nicht sein könne, worauf er nur noch zur
Antwort erhält:
und du warst auch da !
So, was haben wir also ?
Unschärfe, maharaj ji und kc, die beiden in den Bergen, kein Handy mit GPS, kein Förster, welcher die beiden beobachtet.
maharaj ji "befielt" kc zu meditieren, also in samadhi zu gehen, "wo2man dann ist, "was" man dann ist, weiß ich auch nicht
Irgendwann holt maharaj ji dann kc tewari da wieder heraus.
Wir haben also eine gewisse Zeitspanne, in welcher maharaj ji völlig ohne "Beobachtung" war, sprich, es werden jetzt, außer durch ihn selbst, keine weiteren daten zum "Verbleib" - ähnlich wie beim Doppelspaltexperiment - mehr erhoben. Und kc tewari ist "weg", wie gesagt, keine Ahnung, wo oder was oder wie man "ist", wenn man in dieser echten Meditation sich befindet.
So, in dieser Unschärfe, welche "datenmäßig" keine Wellen
schlägt, werden also beide ! bei der Einweihung des neuen Tempels in Neu Delhi
gesehen, nicht allzu lange schienen sie sich dort aufzuhalten, aber lange genug
wohl, wie es sich aus Gründen der Höflichkeit gebiert, bei einer
Tempeleinweihung anwesend zu sein. Diese "Bilocation" ist in und an sich bei
solchen Ausnahmewesen nichts Ungewöhnliches, auch bei Pater pio ist das
desöfteren vorgekommen, doch jetzt kommt's, jetzt wird es "technisch"
interessant, kc tewari war eben auch vor Ort in Neu Delhi, wovon er -
offensichtlich - überhaupt keinen Schimmer hatte.
kc tewari hatte also überhaupt keine "Erinnerung" daran ...
"Wir müssen davon ausgehen, das selbst "Vergangenheit" so
etwas, wie eine Datei ist"
john archibald wheeler
So haben wir also kc, welcher mit maharaj ji kurz bei der Einweihung zugegen ist. Doch was für ein kc ist das ? Dass maharaj ji einfach maharaj ji war, also sich "bewusst" darüber, dass er erst noch hier auf dem Berg, und im nächsten Moment in Neu Delhi bei der Tempeleinweihung war, davon kann man wohl ausgehen. Doch kc hatte halt überhaupt keinen Schimmer, dass "er" eben auch bei der Einweihung war. So, und nun denke ich, dass es fühlbar wird, dass es hier in gewissem Sinne, was so unser Bild von wirklichkeit ist, und wie sie funktioniert, dass sie in gewissem Sinne "technischer natur" ist. Nämlich kc, der Dank Samadhi gottweißwo oder was war, konnte keinen "datenkonflikt" erzeugen, und diese Zeit wurde genutzt, um "ihn", oder einen "systemgenierten" (?) kc tewari bei der Einweihung zusammen mit maharaji ji erscheinen zu lassen, einzufügen.
Wenn also maharaji und kc tewari ganz aus Fleisch und Blut bei der Einweihung kurz zugegen waren - und doch selbst diese Fleisch-und-Blut-wesen doch nur "Einblendungen" gewesen sein können, legt uns das nahe, dass unter Umständen eben alle die scheinbar so "echte" Körperlichkeit, inklusive der eigenen, eine "Einblendung" ist, also auch systemgeneriert, es sich halt nur so anfühlt, als ob, es halt den Anschein hat, als wäre man "als solches" da, eben wie maharaj ji, eben wie kc, eingeblendet "auf dem Berg", und im nächsten Moment halt 14 Autostunden entfernt woanders.
Im Grunde bedeutet das dann, dass jeder hier "von woanders" (also nicht "hier") hier als dieser oder jener generiert wird, sein Tageswerk macht, sich schlafen legt und so fort, und die ganze Zeit eben in dieser Illusion verbringt, das Ganze sei ´"hier", man sei "hier" und existiere durch sich selbst, was aber ebenfalls eine Illusion sein muss, wenn man mal o.g. Beispiel zur Hand nimmt, nach welchem wirklichkeit - wie bei der Enterprise - dich einfach irgendwo hinbeamen, erscheinen lassen kann. Das bringt dann einfach mit sich, dass "Körperlichkeit", "Fleisch und Blutlichkeit", "Dinglichkeit" - eine Illusion sein muss.
Wie man hier tatsächlich auch sehen kann.
Dinglichkeit, Materialität und damit notwendigerweise "Körperlichkeit" ist
offensichtlich: eine Illusion
na
tur
na
=
Schein Anschein Widerschein

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
31.03.2025 n. Chr.
gott seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und regnen über Gerechte und Ungerechte
07.15 Uhr, und gestern haben mich meine Uhren "gefoppt", obwohl ich alle auf "nicht aktualisieren" gestellt hab - sie sind dennoch eine Stunde vorgesprungen, was ich aber erst gegen 20.00 Uhr gemerkt habe, da ich zur Sonne schaute, und sie noch einiges über dem Horizont stand, und mir da erst klar wurde, dass etwas mit der Uhrzeit auf meinem Phone nicht stimmen kann. Computer und Handy haben einfach dennoch aktualisiert (basierend auf meiner Zeit), und so bin ich gestern eine Stunde zu früh hoch zu den hunden.
Mächtig Trübtassenwetter heut', doch ein paar schöne Tage sind wieder in Sicht.
wirklichkeit und Wetter haben tatsächlich sehr viel gemeinsam, nur beim Wetter wir halt nicht sagen "warum geschieht mir das ?", weil eben ganz viele menschen im näheren und weiterem Umkreis den gleichen Widrigkeiten ausgesetzt sind, wir also gelernt haben, das jeweilige Wetter nicht als unser besonderes Schicksal aufzufassen.
Und - es scheint auch dieses Jahr der April zum "Wonnemonat" zu werden, jedenfalls, was die Entwicklung der pflanzen angeht. Das ist mir schon letztes Jahr aufgefallen, alles ist etwas früher dran, als üblich.
Ein fein verteilter Schein, ohne echtes Licht
Ein fein verteilter (mi) Schein (na), ohne (il) echtes Licht (lu), das ging mir heute morgen wieder durch den virtuellen Kopf - Sprache hat sich "jemand" ausgedacht (illumina), wie den Bombardier-Käfer ...
Aus der Zeitschrift "Raum und Zeit".
Kein Wunder, dass es für die Überleitung in die nächste fraktale Ebene der Künstlichkeit (zi) dann einen Protagonisten brauchte, welcher eben natur - und damit auch den menschen - als "aus sich selbst entwickelnd" scheinbar nach- oder bewies. Denn bis Darwin hatten es die menschen überwiegend angenommen, und mache vielleicht "im Blut", dass hier alles eine "Schöpfung" ist. In diesem Wort schwingt bereits "Virtualität" mit, da ja auch Schöpfung meint, dass das Verursachende nicht mit enthalten ist in demjenigen, was geschöpft wurde, sich also "außerhalb" dieser befindet, nämlich "in other", wie edward fredkin, der Vater der digitalen Physik, es immer ausdrückte.
Deswegen vielleicht auch die scheinbare Epoche der "Aufklärung", welche jetzt rückwärts betrachtet, nicht mehr war, als eine Epoche der Verklärung. Denn die Richtung, in die alles mit Nachdruck vorangetrieben wurde, die scheinbar erklärenden Wissenschaften, sind komplett in die gegenteilige Richtung, die falsche also, voran getrieben worden, um der wirklichkeit nachdrücklich ein materielles Antlitz zu verleihen. Auch ein
cogito ergo sum
eines descartes gehört bereits zur Honigfalle. So wissen wir heute weniger denn je, was nun "denken" überhaupt ist, geschweige denn "sein", aber, das "Denken" brauchte dann nur noch im "Kopf" Statt zu finden, in welchem das "Gehirn" zuständig ist - und schon war die Sachje geritzt. Das Gehirn ist materiell, ergo ist Existenz (sum) materiell.
Doch es ist eben alles Bullshit, alles.
Selbst ein schopenhauer ist da nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung, verortete er doch die "Vorstellung" im Kopf, nicht ganz stringent bleibend, dass ja "der Kopf", wie alles andere auch, ja selbst bereits zur zweifelhaften Klasse der "Vorstellungen" gehört. Wie oben manfred spitzer, der eben auch nicht über diese Dichotomie zu stolpern scheint.
Bleibt man konsequent logisch bei der Sache, muss einfach alles Illusion sein, was sich uns so als materiell dar bietet. Das könnte bei manchen sogar die Vermutung anregen, dass das, was eben nicht materiell, also das in unserem Sinne "nicht Messbare" vielleicht gar das Eigentliche, echte ist, wenn schon das anscheinend "Echte" eine Illusion sein muss.
|
"Bei einer Messe in Stuttgart kam ich mit einem bekannten Chemiker ins Gespräch. Ich versuchte ihm zu erklären, daß wir mit dem ausgestellten System Schwermetalle bis zu einem nicht mehr meßbaren Grade reduzieren können. Es handelt sich hierbei nicht um ein Filtersystem, sondern um einen durch Informationsübertragung hervorgerufenen Effekt, der die Selbstheilungskräfte des Wassers aktiviert. Wir haben derartige informationstechnische Trinkwasserreinigungssysteme in einem durch eine Ölraffinerie verpesteten Gebiet in Ecuador installiert. Die Schwermetallbelastung des Regen- und Grundwassers durch Blei und Quecksilber war derart hoch, daß die Menschen in den umliegenden Dörfern reihenweise erkrankten. Die Wirkung des von uns installierten Systems wurde damals durch wissenschaftliche Meßreihen begleitet und bestätigt, das Resultat läßt sich aber auch in wenige Worte packen: klares Trinkwasser mit signifikanter Reduktion von Schwermetallen! Ich erinnere mich noch genau daran, wie ihn diese Erklärung zur Weißglut brachte. Was ich da sage, so der Sachverständige, könne es alles nicht geben! Ich bot ihm kurzerhand an, daß er das System mit meinen Produkten gerne bei sich im Labor testen könne.
Gleichzeitig fragte ich ihn aber auch, was er denn machen würde, wenn er am Ende tatsächlich auf dasselbe Ergebnis käme; er würde es, so sagte er, dennoch nicht glauben, denn was ich von mir geben würde, könne einfach nicht sein, da sonst die ganzen wissenschaftlichen Denkmodelle falsch wären ! Bei ihm stapelten sich die Bücher, und viele nahm er zur Hand, um mir meinen Irrtum deutlich zu machen. „Roland“, sagte er, „hier steht überall, daß das nicht sein kann, was du da machst !“
roland plocher, wenn einer weiß, was irgendwie sonst keiner weiß ...
|
Australian national University, 27 mai 2015:
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
https://health.anu.edu.au/news-events/news/experiment-confirms-quantum-theory-weirdness
Prof. tuscott gibt freimütig zu: es gab diese "Atome" nie wirklich ...
|
|
Zwar zweifelsohne diese wirklichkeit eine vollkommene, oder nahezu vollkommene Illusion ist, es nicht mit sich bringt, dass sie keine Bedeutung hat. Das ist es, so glaube ich, was der Materialist immer falsch versteht, wenn man von der "Maya" redet, von der Illusion. Denn für ihn ist ja nur das "Materielle" "echt", welches allerdings, wie oben mit dem Phthalocyanin-Molekül, nachweislich nicht echt sein, auch wenn man es leibhaftig "aus Materie bestehend" bestellen kann.
Der Materialist somit sofort das Kind mit dem Bade ausschüttet, wenn er hört "Materie ist vollkommene Illusion" - weil er eben Bedeutung nur im Materiellen sieht, oder gar finden kann. Dass, wie im Theater, die Bedeutung im Stück, also der ganzen Aufführung als solchen, den darin ausgedrückten Beziehungen, moralischen Komponenten liegen könnte, kommt ihm (erstmal) nicht in den Sinn. Auch ein erheblicher Mangel an Logik und Urteilsvermögen ist bei dem Materialisten fest zu stellen, respektive - in meiner Sprache - hat er halt so gut wie keine Freischaltungen erhalten (bliss, gnade).
Warum ?
Na darum ...
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|

01.04.2025 n. Chr. 07.59 Uhr
| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."
Heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.
|
Tja, jetzt ist bald schon wieder Mai, und dran denken, wenn der Mai um ist, dann steht letztlich auch Weihnachten wieder vor der Tür. Nicht mehr weit, und auch die Tage werden wieder kürzer. Das leben ist halt kürzer, als die Sommerferien.
Mein Großvater pflegte zu sagen: „Das Leben ist erstaunlich
kurz. Jetzt in Erinnerung drängt es sich mir so zusammen, daß ich zum Beispiel
kaum begreife, wie ein junger Mensch sich entschließen kann, ins nächste Dorf zu
reiten, ohne zu fürchten, daß — von unglücklichen Zufällen ganz abgesehen —
schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden Lebens für einen solchen
Ritt bei weitem nicht hinreicht.“
franz kafka, das nächste Dorf
Was nehmen wir daraus mit ? Um es mit krishna das zu sagen: "i don't know". Die einen jammern. dass Alles so schnell vorbei geht, wieder andere sind heilfroh, dass sie dann endlich wieder von der Bühne herunter gehen, den Körper verlassen können, wie neem karoli baba, aber auch viele andere. Wie meinte luca, mit seinen 25 Jahren, noch zu mir, als ich meinte, dass er das ganze Theater hier ja noch ziemlich lange wird mitmachen müssen: "ich hab' jetzt schon keinen Bock mehr". Aber klar, das Ganze hier ist ein - wie tom cambell sagt - "Erfahrungspaket", und wie es bisher aussieht, ein sogar gebuchtes, wie ein Urlaub, welcher ja seine schönen aber desöfteren eben auch seine unerwartet unschönen Seiten haben kann. Oder wie ein Arbeitsaufenthalt im Ausland, man weiß, man muß "ran", doch man macht das ganze ja nicht zum Spaß, sondern, um sich etwas zu verdienen. Das trifft es vielleicht noch besser, als "Urlaub". Denn wenn man atmen muß, um zu existieren, kann es ja kein Urlaub sein.
Übrigens, wie viele existenzielle Entscheidungen treffen wir jeden Tag, wie viele Erwägungen von großer möglicher Konsequenz, welche auf dem Fuße folgen könnten ? So gut, wie gar keine ? Doch wie sieht es aus im Krieg ? Genau, völlig anders, dort ist die Zeit, die man wach ist, beinahe in jeder Sekunde geprägt von möglichen einschneidenden Konsequenzen, was unsere Entscheidungen und Erwägungen angeht. Weswegen die allermeisten Computergames ja eben genau so gestrickt sind. Erst später kamen dann die etwas "sophistizierteren" Spiele auf den Markt, wie etwa einen Landwirt zu spielen, welcher langfristig zu entscheiden, und dazu noch der Unschärfe des Wetters ausgeliefert ist, welche er, so gut es geht, mit einzuberechnen hat. Doch da eben alle Landwirte in einer Region mehr oder minder des gleichen Wetters ausgesetzt sind, hätte man neben dem absoluten Resultat (der "Ernte") auch noch ein relatives, eine Vergleichsmöglichkeit, nämlich - wie gut haben die anderen abgeschnitten ?
So lernen wir auch von anderen, oder ? Ja, so sieht es aus, es scheint das Offensichtlichste der Welt zu sein, Doch ist das wirklich so ? Wovon hängt es denn ab, wie gut oder wie schnell wir dazu lernen - das kann ja wiederum nicht in unserer Macht stehen, darauf haben wir keinen Zugriff, ebenso, wie wir keinen blassen Schimmer haben, welcher Gedanke unser nächster sein wird. Wer oder was entscheidet denn, dass wir lernen, was wir lernen ? "Wir selbst" können das ja nicht sein. Man sagt dann zum Beispiel "es ist ihm in die Wiege gelegt", um halt zu kennzeichnen, dass es da etwas gibt, was schlichtweg außerhalb unser Reichweite ist.
Dummheit ist recht eigentlich ein Mangel an Urtheiskraft.
Ein Gebrechen, welchem gar nicht abzuhelfen ist.
immanuel kant
Aber alles ist und bleibt relativ, wie schopenhauer formulierte "auch Gulliver nur so groß war, weil die anderen so klein". Übrigens, um hier das Wesentliche - was eben nicht das Intellektuelle ist - dazu zu lernen, ist es völlig egal, wie dumm oder "klug" du bist. Ein strohdummer Klotz mit dem Herzen am richtigen Fleck kann dennoch mehr Punkte hier einfahren, als leonardo da vinci. Für das Spiel hier sind die intellektuellen Kapazitäten völlig unerheblich, wenn in sehr hohem Maße vorhanden, sogar dem Lehrstück abträglich. Heißt es ja, "selig sind die geistig Armen", und wenn man unter geistig denn damals das Intellektuelle verstanden hat, passt das ja.
Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar
antoine de saint-exupery
Ja, was wir mit den Augen sehen, den restlichen Sinnen wahrnehmen ist halt alles nicht mehr als die Bühne - und die ist eben nicht das Wesentliche. Die kann so oder auch wieder völlig anders aussehen. Das in oder auf der Bühne gespielte Stück ist das Wesentliche, respektive seine inhärente Bedeutung oder Lehre. Wenn wir uns ein Video anschauen, wie man beim Handy selbst die Battery wechselt, so sind es doch nicht die unterschiedlich farbig aufflackernden Pixel auf dem Bildschirm (daten), welche das Wesentliche ausmachen, sondern die durch diese sich transportierende Information, hier in unserem Falle: wie man eben die Battery eines Handys selber wechselt. Und was wir wahrnehmen, gerade was das Sehen angeht - sind tatsächlich Pixel, nur eben so so klein, dass wir es nicht wahrnehmen, dass hier alles digital erzeugt ist, eben wie auf der Mattscheibe. Die Größe der Pixel kann man sogar bei Wikipedia nachlesen, welche dazu natürlich nichts weiter schreibt, man soll ja bekanntlich keine schlafenden hunde wecken ...
wirklichkeit ist nunmal kein Kontinuum sondern diskret, mit einem anderen Wort: digital. Ebenso - genau wie beim Computer - ist es mit der Zeit, sie hat ebenso eine kleinste Taktfrequenz. Auch unsere Zeit ist getaktet, und die kleinste Zeiteinheit ist die planck-Zeit: 5.391247(60)e-44 s, was ziemlich kurz ist. So kurz, dass wir niemals auch nur in die Nähe kommen werden, zu bemerken, dass unser Bild hier, also was wir scheinbar mit den Augen sehen, letztlich "ruckelt". Aus diesen beiden resultiert dann schließlich, wie schnell ein Pixel den Raum durchlaufen kann, und voila, das nennen wir Lichtgeschwindigkeit. Im Prinzip ist also alles ganz einfach. Und das Einfache ist ja, wie wir wissen, das Siegel des Wahren.

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
02.04.2025 n. Chr. 08.21 Uhr
Wären wir reif genug gewesen,
spirituell gesehen - eine einzige Geschichte wie diese von maharaj ji,
wäre
ausreichend gewesen, um unseren geist [also unsere übliche Auffassung von
wirklichkeit]
zu vernichten.
Aaaaaalter Schwede, die Träume hatten mich mächtig im Griff, bis
zur letzten Sekunde vor dem Aufwachen. Einer der letzten kafkaesk, wie dieser
hier:
Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als
ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, daß es schon viel später war,
als ich geglaubt hatte, ich mußte mich sehr beeilen, der Schrecken über diese
Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt
noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich
lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: „Von mir
willst du den Weg erfahren?“ „Ja“, sagte ich, „da ich ihn selbst nicht finden
kann.“ „Gibs auf, gibs auf“, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge
ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.
franz kafka, gibs auf.
Sonne satt, doch Glück gehab, hier schramme ich knapp an einer Wolkendecke vorbei
Ha,, und der Blattkaktus (Epiphyllum) beginnt ordentlich viele Blüten auszutreiben, nachdem ich ihm einen größeren Topf mit mehr Erde spendiert habe, so viele, dass es eine Schau werden dürfte. Irgendwie muß das dieses Jahr auch was mit der Bestäubung werden, weil die Früchte sind super-lecker und mit einem exotischen Geschmack, welchen ich in dieser Zusammensetzung noch nie erlebt habe. Also wahrscheinlich dann raus auf den Balkon, dass die Bienen die Arbeit übernehmen, und halt drauf achten, dass er bei Frost hinein kommt.
Der Leiter einer Polizeiwache in Indien muß zu einem Auswärtseinsatz, und kommt erst spät gegen 11 Uhr wieder zurück. Er schaut noch in der Wache vorbei, was so los gewesen ist, und seine Kollegen meinen nur, dass es eine Festnahme gab wegen § (Section) 109.
Den Rest könnt ihr jetzt nachlesen, oben links geht es weiter. Nur soviel, früh am morgen kommen seine Kollegen zu ihm, mit schlotternden Knien, und wollen kündigen ...
Wären wir reif genug gewesen,
spirituell gesehen - eine einzige Geschichte wie diese von maharaj ji,
wäre
ausreichend gewesen, um unseren geist [also unsere übliche Auffassung von
wirklichkeit]
zu vernichten.
ich bin jetzt bei Geschichte Nummer 114 ...
W


Und hier ist auch noch reichlich drin, aus erster Hand, von krishna das - das "lila" also Spiel von maharaj ji.

Das war's auch schon wieder, mehr braucht es ja auch letztlich - eigentlich - nicht, um sich klar zu werden, dass man in einer Art Traum sich hier befindet.

03.04.2025 n. Chr. 08.13 Uhr
Heute wieder satt Sonne, wobei man aber sehen kann (noch), dass selbst kleinere Städte so ihre eigene Dunstglocke haben, hab' mal nur einige angekringelt ...
Vorhin mußte ich kurz zurück denken an die Zeit vor dem "Aufwachen, und ich noch so komplett vertieft in die Motorräder war. Man wusste von garnichts, glaubte noch ein wenig den "Nachrichten", glaubte, dass es "Länder" gibt, "Geld" und "Schulden", glaubte, dass Ärzte dazu da sind, menschen gesund zu machen, dass die GEZ den ÖRR finanziert, und natürlich, was das Wichtigste ist, man glaubte, dass das Ganze hier doch irgendwie "Materiell" und "echt" ist - und natürlich auch als solches hier Statt findet.
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
prof. tuscott, Australian national University, 27 mai 2015 - Link
Der letzte ist natürlich der fundamentale Punkt. Von dem aus muß letztlich Alles ! neu gedacht werden, da auf der Grundlage, dass wirklichkeit in wirklichkeit nicht hier geschieht, sondern "in other" (edward fredkin) absolut garnichts das oder so sein kann, wie es uns erscheint. Jede irdische, "materielle" Deutung oder Erklärung von auch nur irgendwas ist damit einfach nichtig, müßig.
"jaja, es erscheint so, nur faktisch kann es nicht an dem sein ..."
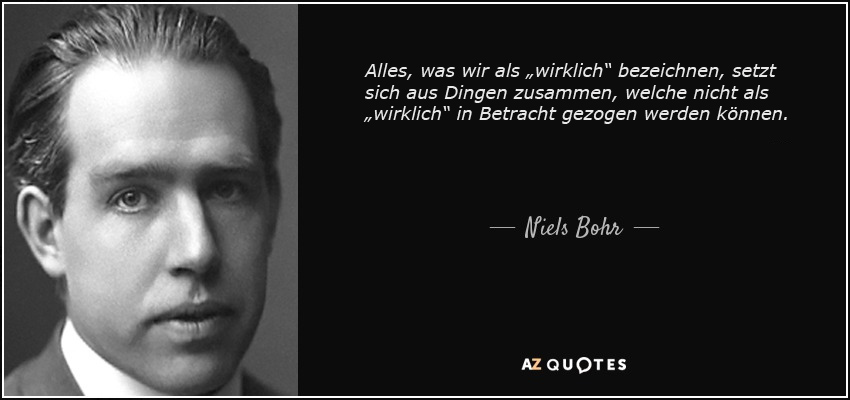
Sicherlich muss man dann beinahe jede Sekunde sich der überschwänglich "materiell" sich aufdrängenden wirklichkeit erwehren, was unmöglich ist, oder jedenfalls zu sein scheint - und das wiederum kann eine gute Erklärung sein, warum maharaji ji beständig ram ram ram .. murmelte, und auch in Pausen, wenn er nicht mit den Devotees redete, man seine zu7nge immer sich bewegen sah, er innerlich sozusagen "ram ram ram .." etc. zu sich sprach.
Ebenso das Tagebuch, was er führte, war nur gefüllt mit diesem einen Wort.
So gelingt es mir (natürlich ?) so gut wie überhaupt nicht, diese wirklichkeit als den Traum zu spüren, welche sie ist. Nur wenn ich ein paar Seiten aus diesem Buch hier gelesen habe, wenn ich mit dann - nach vielleicht einer halben Stunde des Lesens - das Buch beiseite lege, ist es für mich ein wenig zu spüren, dass man sich grad tief in einer Art von Traum befindet. "Die göttliche wirklichkeit", wie der Titel schon sagt ...
Wären wir reif genug gewesen,
spirituell gesehen - eine einzige Geschichte wie diese von maharaj ji,
wäre
ausreichend gewesen, um unseren geist [also unsere übliche Auffassung von
wirklichkeit]
zu vernichten.
Vielleicht wurde mir (und franzi) damals auch deswegen der ruckelnde Mond gezeigt, auf das man einfach einen festen Ankerpunkt hat, auf welchen man sich bei den größten Zweifeln immer wieder zurück ziehen kann. So eben mir und franzi letztlich die Digitalität von wirklichkeit schlicht und einfach demonstriert wurde, wie man dann sagt "w.z.b.w", also: was zu beweisen war. Nur, und das bedeutet eben auch - und so habe ich ja begonnen, dass demnach eben auch wirklich ALLE unserer üblichen Erklärungen von auch nur irgendwas, nur Stuss und Tinnef sein können, da sie ja - üblicherweise - auf einer materiellen Auffassung von wirklichkeit basieren.
Nur jetzt kommt, für das Nicht-Echte, für den Schein, die Maya, dort haben wir Worte. Für das Echte, was diesem Schein zu Grunde liegen, diesen bedingen muß, das Primäre also, fehlen uns diese ...
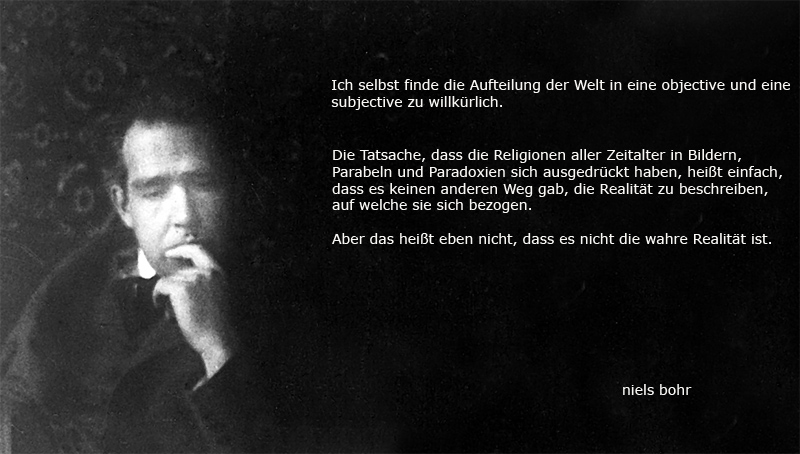
Also ist zwar leicht gesagt, dass man wirklichkeit komplett neu denken muß, doch eben all unsere Begriffe stammen aus dem Traum, damit auch unser Denken, sofern es sich innerhalb dieser Begriffsblase bewegt, garnicht aus diesem Zirkel hinaus sich bewegt. Sobald wir im üblichen Sinne "denken", werden wir im Grunde immer wieder in die Materialität, die scheinwirklichkeit hineingezogen, weil eben all unsere Begriffe nur Begriffe dieser wirklichkeit, dieses Traumes sind. Wohl deshalb auch die Meditation, um eben diesen Prozess mal zum Schweigen zu bringen, welcher einen beständig wieder in den Traum, die letztlich sekundäre scheinwirklichkeit hinein zieht.
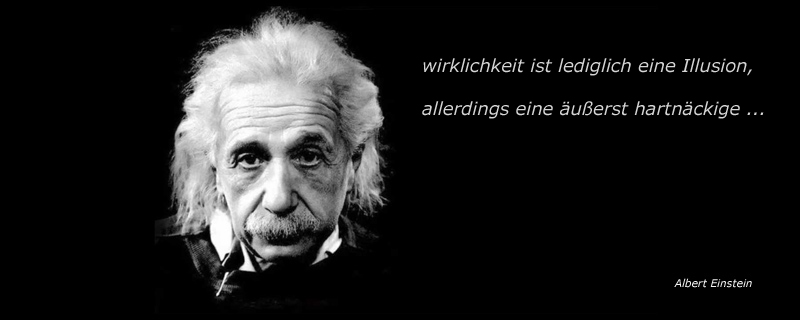
Nur eben auch: das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es ist zwar (lediglich ?) ein Traum hier, nur ist er deshalb nicht bedeutungslos, sondern hat seinen Sinn und Zweck ...
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
04.04.2025 n. Chr. 08.09 Uhr
Holla, wieder mal ein durchgehend blauer Himmel, und Sonne satt.
Doch tatsächlich, auf der Zoom-Earth Webseite kann man so kleine
"Watte-Pünktchen" erkennen, jedes kleine Städtchen sogar scheint seine
Dunstglocke zu haben. Würde wetten, dass auch die nicht benannten Städte überall
dort zu finden sind, wo man diese Wattebäuschchen sieht.
So könnt ihr ja mal euren Ort checken: https://zoom.earth/maps/satellite/#view=51.4018,10.9944,7z
Von Nordwest rollt jetzt übrigens mächtig Kaltluft heran, also genießt den Tag. Und der Blattkaktus auf dem Tisch hier macht sich, allein schon die Knospen sind ein kleines Kunstwerk. Wer sich die wohl ausgedacht hat ? Naja, jedenfalls eine gewisse Fraktalität ist unschwer zu erkennen, wie unten so oben, wie im Kleinen, so im Großen, kein Byte wird hier verschwendet.

Doch letztlich ist es doch ganz angenehm, dass wirklichkeit analog und als Kontinuität uns erscheint, auch wenn sie letztlich und faktisch digital und diskret ist. Wäre aber auch nervig, wenn wir alles nur als ruckelnde Bauklötzchen wahrnehmen würden.

Tja, und bei dieser "Quantenspringerei" ist es geblieben. auch einstein hatte in Princeton noch 28 Jahre lang versucht, die Implikationen des Doppelspaltexperimentes - also, dass dieser wirklichkeit keine "Materialität" zu Grunde liegt - wieder rückgängig zu machen, es ist ihm jedoch nicht gelungen. Daher er ja dann im Alter sich geschlagen geben musste.
"Einstein hat mal zu Niels Bohr, gesagt: Glauben Sie wirklich,
dass der Mond nicht da ist, wenn keiner hinsieht? Und Niels Bohr soll ihm
geantwortet haben: Beweisen Sie mir doch das Gegenteil “
"Der Gedanke, dass ein Elektron aus freiem Entschluss den Augenblick und die
Richtung wählt, in der es fortspringen will, ist mir unerträglich. Wenn schon,
dann möchte ich lieber Schuster oder Angestellter in einer Spielbank sein als
Physiker."
Brief (1924) an max born zitiert in
albert ainstein und max born, Briefwechsel, Rowohlt, Reinbek,
1969, S. 67
Quelle
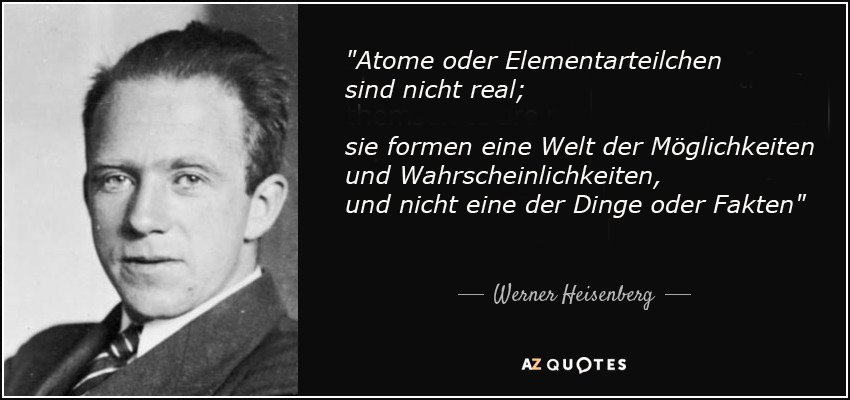
Was zu beweisen war. Am Ende ist alles, was wir erleben, was Gegenstand unserer Wahrnehmung ist, sowohl subjektiv als auch objektiv, eine mentale Geschichte, etwas sozusagen "Geistiges", auch wenn es sich martialisch materiell präsentiert, wie etwa ein Panzer. Auch dieser ist nur Information, und erscheint halt super-solide, aufgrund des Regelwerkes. Würde man die gesamten 30 Tonnen zermahlen zu feinstem Pulver, und einzeln die Moleküle durch einen Doppelspalt schicken, man würde sich gewahr werden, in der Tat, der gesamte Panzer war stets nur: information.
Es waren letztlich nur virtuelle "Moleküle", welchen diesen scheinbar so soliden Panzer ausgemacht haben.
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
prof. tuscott, Australian national University, 27 mai 2015 - Link
Alles ist sozusagen "mental", auch wenn es noch so solide,
schwer, im Raume ausgedehnt
uns erscheint. Oder halt noch einfacher ausgedrückt, dasjenige, worin wir uns
befinden,
oder besser: zu befinden scheinen - ist eine Art von Traum.
Warum wird es hell ?
Weil die Sonne scheint ?

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
05.04.2025 n. Chr. 08.10 Uhr
Das leben hat nicht glücklich zu verlaufen, nicht
unglücklich,
sondern nur Eines: lehrreich
"There's just one thing, that ram loves, and that is: love"
krishna das
Hier kann man gut sehen, die Kälte kommt gleich ganz direkt aus dem Norden.
Für Anfang April natürlich nichts Ungewöhnliches. Doch eben das vorherige warme Wetter viele Pflanzen zur Blüte angeregt hat, und Blüten vertragen mehrheitlich keinen Frost. Daher auch ich schauen muss, dass ich die Pfirsichblüte über die morgen kommenden Nächte "rette". Die Bäumchen sind noch klein, von daher das eine überschaubare Aufgebe wird. Die Sauerkirschen sind zumeist noch im Knospenstadium, die sollten bis ~ -3,5°C laut Literatur aushalten, und Stand heute sind min. -2°C angesagt.
Auch habe ich mir 3 Bäumchen gekauft, alles Halbstamm, 2x Birne
(Clapps Liebling, Gellerts Butterbirne), weil die nicht selbstbefruchtend sind,
und 1x Zwetschge. Allerdings, da ich im Grunde nur sehr wenig Platz habe, muß
ich mich im Verschneiden üben, um sie eben klein, und dennoch irgendwann
ertragreich zu halten. Da Bäumchen sind von den Triebspitzen bereits 2,50 Metzer
hoch, da werde ich die Tage noch verschneiden, um die Verzweigung anzuregen,
denn gerade die Birne soll sehr "kopflastig" sein, also mit einen starken
Austrieb gen Himmel.
Nun, alle Geschichten sind natürlich lesenswert, hier jetzt Nr. 129 und 130 ...
Now see, he is saved ...
Wären wir reif genug gewesen,
spirituell gesehen - eine einzige Geschichte wie diese von maharaj ji,
wäre
ausreichend gewesen, um unseren geist [also unsere übliche Auffassung von
wirklichkeit]
zu vernichten.
Zurück blickend war es eigentlich nicht wirklich schwierig, zur Erkenntnis zu gelangen, dass es sich mit dem "Hier" um ein multi-Player-Lernspiel im Traumformat handelt, in welchem es um etwas geht, halt die "Punkte", welche man einfährt. Gut, von den Anfängen, dem "Aufwachen" bis jetzt waren es 14 Jahre, mit steter Wandlung der Perspektive auf das Ganze hier - wenn eben neue Fakten vom Boden dazu kamen.
Irgendwo vor 7 Jahren ...
mirin dajo

bruno gröning
therese neumann

Das war halt vor ungefähr 7 Jahren, und solche gelebten Beispiele aus Deutschland, also nicht irgendwie weit weg, mit tausenden von Zeugen, lassen dann schonmal den Damm aufweichen, das Eis "knartschen", schlicht durch die Last des empirischen Vorganges. Klar, zu diesem Zeitpunkt bestand noch immer das Problem, dass im "physischen" Paradigma das Alles nicht hätte angehen dürfen, und dennoch "ging" es ja, Massenheilungen mit nur ein paar Worten (bruno gröning Traberhof Rosenheim), ein mirin dajo, welcher sich unzählige Male mit Degen durch den Körper stechen ließ, auch vor Ärzten, mit anschließender Röntgenaufnahme, und schließlich therese neumann, die sogar durch ihre Stigmata und Nahrungslosigkeit bereits + 1930 war, dass paramahansa yogananda sie in dieser Zeit besuchte, adolf hitler zwar viele um therese neumann herum einkerkern oder ermorden ließ, doch, wie man sagt, "höchstpersönlich" die Anweisung heraus gegeben hat, dass therese davon ausgenommen ist, obwohl sie klar im Widerstandszirkel eine zentrale Rolle einnahm. Was mag adolf hitler gedacht haben ? "Mit gott selbst lege ich mich besser nicht an" ?
erwin von aretin ist auch verewigt.
Schließlich die amerikanische Armee bei der "Befreiung" Deutschlands auf den Kriegskarten einen roten Kringel um Konnersreuth hatten, wo eben therese lebte - mit der Order, dort keinen Schaden anzurichten. So glaube ich es bei Freiherr von Aretin gelesen und auch Bilder gesehen zu haben, wie die amerikanische Armee alles für therese getan hat, sogar mit dem Hubschrauber das Kreuz ganz oben auf der Kirche wieder angebracht hat. Auch sei hier noch pater pio zu erwähnen, über welchen es auch einen schönen Film gibt.
So, nun bestand aber immer noch diese Art "Dichotomie", dass diese Fakten vom Boden sich mit dem "§physischen" Paradigma nicht vereinbaren ließen, welches ja die alte newtonsche Weltsicht ist, welche auch mir noch als "letzter Stand der Wissenschaft" eingeredet wurde. So richtig fest in diesem Glauben verankert war ich, dass ich niemals geglaubt hätte, dass von Seiten (echter!) Wissenschaft etwas kommen könnte, was eben dieses alte, newtonsche Weltengebäude in sich zusammenstürzen lassen könnte. Zwar hatte ich schonmal was von "Quantenmechanik" oder "Quantenphysik" gehört, und hie und da ein bisschen was überflogen oder angeschaut, doch der Sozialismus (there aint no such thing as a free Lunch) hat mir natürlich den einfachen schnellen Zugang verwehrt. Und selbst max igan, dem ich damals vioel und gern gelauscht habe, hatte es beinahe nicht vermocht, mich zu überzeugen, mich an eine gewisse Materie herran zu machen. Es ist ihm zu verdanken, dass ich mich irgendwann mit dem Doppelspaltexperiment (DSE) beschäftigte, denn über beinahe ein Jahr wiederholte er in seinen Podcasts wieder und wieder das DSE (double Slit Experiment), doch ich hatte überhaupt keine Lust, mich mit dröger Physik zu beschäftigen
da ich niemals erwartet hätte, dass die Wissenschaft sich selbst aushebeln könnte, oder würde.
Doch irgendwann war ich dann von max igan weichgekocht, so oft "double Slit Experiment" von ihm gehört, dass ich mich irgendwann, schweren Herzens, daran gemacht hatte. Doch das mit dem "schweren Herzen" dauerte nicht lange, nur Sekunden vielleicht, denn bereits nach diesen wenigen Sekunden, welche ich die ersten Einsichten in das DSE erhielt, war ich Feuer und Flamme. Tja, und nach einem wirklich intensiven Studium war das Eis gebrochen, der Damm gebrochen, einfach alle "physische" Sicht der Dinge in sich zusammen gebrochen, ein bruno gröning, mirin dajo, eine therese neumann war nun problemlos möglich. Wie im Grunde jetzt alles möglich ist, sogar dasjenige, was sich nicht einmal mehr denken lässt. Und das: problemlos.
Das "Wunder" ist das Normale.
Und das "Normale" ist das Wunder.
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
prof. tuscott, Australian national University, 27 mai 2015 - Link
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
11.04.2025 n. Chr. 08.48 Uhr
Schlaf nachgeholt, doch hier, mehr nordöstlich gelegen, ist es wieder bewölkt, und bleibt wohl aus so. Auch wenn nicht wirklich kalt, wird es ein "drinne"-Tag, doch die win-win Situation ist, dass ich dann mit dem Kabelbaum beim Motorrad weiter komme, insofern das trübe Wetter auch seine Vorteile hat. Und so ist es mit dem leben eben wie mit dem Wetter, man sieht zu, oder sollte zusehen, dass m an das Beste daraus macht. Solche "win-win" Situationen sind ja eher selten, zumeist ist unserer wirklichkeit durchwachsen, und wenn man es gut hat, dann lösen die lichten und dunklen Zeiten einander schnell ab. Pech hat man dann, wenn man lange ausharren muß, um mal endlich wieder Licht am Horizont zu sehen, das gleicht dann einem Winter für den geist, welcher sich, wie etwa bei krishna das, nachdem neem karoli baba sich hier ausgeloggt hat - 21 Jahre hing er in einem dunklen Loch fest, mit viel Drogen, bis er dann 1994 erst begann, das neue, lichte Kapitel seines lebens anzugehen, welches immerhin bis heute anhält. Bei ram dass war das umgekehrt, er musste die letzten 20 Jahre nach dem Schlaganfall eine nicht mehr so unbeschwerte Zeit durchmachen - fast durchgängig auf fremde Hilfe angewiesen - doch er sagte selbst, dass der Schlaganfall (und die damit einhergegangene teilweise Lähmung) ihm das leben gerettet hat. Warum ? Nun, weil er halt noch so viele, und riesige Baustellen des so genannten "Egos" hatte, an welchen nun gar keine Chance mehr hatte, vorbei zu kommen. Eitelkeit, Stolz, das Gefühl genereller Überlegenheit, und so weiter - all das mußte nun zwangsläufig angegangen werden, und auch weichen. 20 Jahre er in diesem Zustand der Hilflosigkeit seine Lehren ziehen konnte, durfte, musste, vielleicht auch sollte, bis die ganze Rolle dann schließlich "rund" war, und er endlich eines schönen Tages wieder heraus konnte. Wie schon maharaj ji am letzten Tag frohlockte:
"Heute werde ich aus dem Zentralgefängnis [dem Körper] entlassen"
Das ist das Gute, was jeder hier für sich mitnehmen kann - niemand hier wird seine Rolle ewig spielen. Ob langweilig, qualvoll, voll Zweifel und Zaudern, oder auch nur scheinbar glücklich vor sich hin plätschernd, eines schönen Tages kommt man da raus, wird aus dem "Gefängnis des Körpers" entlassen. Viele, die eine sehr bedeutungsloses und von wenig lehrhaftes "leben" "leben" (sie leben in dem Sinne eigentlich nicht", bekommen dann kurz vor Ende nochmal Krebs oder ähnliches, damit sie wenigstens auf ein paar Jahre sich dann nochmal mit etwas tieferen Schichten des seins beschäftigen, und so immerhin dann zwangsläufig nochmal ordentlich ans lernen kommen. Bei ram dass, so hatte es siddhi ma gesagt, gehörten seine letzten 20 Jahre mit der Lähmung, und eben auch der enormen Beeinträchtigung seines Vermögens zu sprechen, sich auszudrücken, zu der Abgerundetheit eines Karmas. Somit ram dass dann durchmachen durfte.
ram dass zu maharaj ji:
"ist Leiden Gnade ?"
Antwort von maharaj ji:
"das kann ich in der Öffentlichkeit nicht beantworten"
Interessant ist der Zusammenhang zwischen Leiden und lernen, aber auch, dass je mehr man leidet, desto "schöner" sich auch der Moment (wohl) anfühlt, wenn man aus diesem "Gefängnis" des Körpers endlich wieder heraus kommt. Und jetzt kommt's - maharaj ji noch nicht einmal leiden brauchte, um sich zu freuen, aus dem Körper heraus zu kommen. Doch er natürlich wusste, was das hier ist, also diese wirklichkeit, daher er sich logischer Weise freute, dass nun endlich der Tag gekommen ist, an welchem er nicht mehr an den Körper gebunden ist. Je mehr man also weiß, was das hier ist (es bei den Meisten mit einer Ahnung beginnt), oder gar spürt, desto mehr wird man kaum erwarten können, aus dem Körper, dem "Zentralgefängnis" wieder heraus zu kommen. Umgekehrt, wer weniger man weiß, was das hier ist, respektive es nicht einmal spürt, ein "laues" leben ohne wirkliche Bewusstheit führt - desto weniger freudig man diesen Zeitpunkt erwartet.
Im Grunde es sich also immer perfekt ausgleicht. Außerdem wird wohl das Moment, dass man zu spüren bekommt, was das hier ist - auch wieder der Gnade unterlegen sein, soll heißen - man es (direkt) über den Willen nicht erreichen, sondern es wird "zugeteilt", freigeschaltet, was auch immer die Gründe dafür sein mögen. So kann ich nur luca wiederholen, welcher mir - als ich zu ihm sagte, dass er ja noch eine ganze Weile hier voraussichtlich mitmachen werde(n müsse) - antwortete: "ich hab' jetzt schon keinen Bock mehr".
Jedenfalls ist somit auch die Einrichtung des Alters, und seiner
beinahe notwendig sich ergebenden Beschwerlichkeiten geradezu ein Gnadenakt. Bei
nicht wenigen menschen sorgt dieser dann sogar schließlich auf eben diese Weise
dafür, dass sie sich dann letztlich doch (irgendwie) freuen, dass das,
gottseidank, auch in nicht allzu ferner Zeit mit der Beschwerlichkeit sein Ende
gefunden haben wird. Weil - niemand hier müsste alt werden. Es gibt keinen
"biologischen Prozess", das sind alles Plausibilitäten aus
spielearchitektonischen Gegebenheiten heraus. Degeneration der "Enzyme",
"Proteine", "Mitochondrien" "DNA" und was weiß ich - sind sämtlich materielle
"Erklärungen", und damit: keine.
Aber - es ist eine Gnade, dass es so eingerichtet ist, und wir - jedenfalls
nicht wenige - dann doch irgendwann soweit sind, dass sie selbst aus freien
Stücken soweit sind, dass sie sich freuen, endlich bald aus dem Körper, dem
"Zentralgefängnis", wieder entlassen zu werden.
Immer dran denken, niemand müsste "alt" werden, es ist ein Videogame hier.
"The atoms did not travel from A to B.
It was only when they were measured at the end of the journey
that their wave-like or particle-like behavior was brought into existence," he
said.
prof. tuscott, Australian national University, 27 mai 2015 - Link

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
13.04.2025 n. Chr. 08.11 Uhr
"Ich erinnere mich an viele Diskussionen mit Bohr, die bis
spät in die Nacht dauerten
und fast in Verzweiflung endeten. Und wenn ich am Ende solcher Diskussionen
allein einen Spaziergang im benachbarten Park unternahm, wiederholte ich immer
und immer
wieder die Frage, ob die Natur wirklich so absurd sein könne,
wie sie uns in diesen Atomexperimenten erschien."
werner heisenberg
Sonne ! Blitzeblauer Himmel, doch ich schaue hier auch gegen
Südsüdost, doch aus dem Westen kommen bald Wolken. Mit Glück bleibt es aber ein
Mix aus Sonne und Wolken über den Tag, bei bis zu 22°C, Mitte April, und die
weiteren Aussichten sind auch erstmal so gut, dass ich die Zitrone jetzt schon
auf den Balkon gestellt hab', muß jetzt nur auf Frost achten, denn dann muß sie
kurz wieder hinein. Auch das Kunstwerk der Knospe vom Blattkaktus kommt voran.
Zur gegenwärtigen "win-win" Situation, gestern war es ja bewölkt, grau, ich dachte mir "Mist, keine Sonne", habe mich aber dann an den Kabelbaum beim Motorrad gemacht, war auch so richtig, drin, es ging voran, und dann gegen 12.30 Uhr jedoch, brach - so nicht ganz vorher gesagt - die Sonne durch, und ich dachte mir "Mist, Sonne", denn das hieß ja, dass ich raus muß um im Garten zu puscheln, meint, irgendwas zu machen, Hauptsache draußen. Was für ein Glück mit dem Wetter haben wir jetzt schon seit dem März ? Also ich kann mich nicht erinnern, so viele schöne sonnige und auch nicht wirklich kalte Tage gehabt zu haben, wenn ich so an die letzten 6 Wochen zurück denke. So hab ich jetzt schon tief richtig "Farbe" im Gesicht.
Hier. Wasser in Wein zu verwandeln, das kennen wir ja bereits. Doch jetzt eine noch weitere praktische Anwendung, wenn man die Freigabe dafür hat :-)
Ja, das kommt bekannt vor. So könnte ich fast jedes der nieder geschriebenen Erlebnisse mit maharaj-ji hier einbinden, da im Grunde alle Zeugnis davon ablegen, dass wir uns von der Beschaffenheit her in einer Art Traum befinden müssen.
Nicht der Traum ist dem leben, sondern das leben dem Traum verwandt.
Immerhin haben indische Ingeneure noch den Schneid, wirklichkeit in seiner struktur anzuerkennen. Was hat maharaj-ji mit indira gandhi zu tun, also der ehemaligen indischen Präsidentin ?
Noch viel viel mehr habe ich aus dem Buch abfotographiert, und werden, und werde diese kleinen und größeren Geschehnise rund um maharaj-ji immer mal wieder hier einstreuen. Auch von krishna das empfohlen :-)

Auf deutsch gibt es auch eine Sammlung, zusammengestellt von ram dass, und eben auf Deutsch übersetzt, ist halt nicht mehre so einfach aufzutreiben, da sich die Neuauflage jetzt schon über Jahre dahin zieht. Der Termin wird immer hinaus geschoben, daher ich mir das Buch über die online-Antiquariate noch besorgt habe.
Wer mit dem Englischen kein Problem hat - hier das Original, überall (noch) verfügbar:

Die Bewertungen und Rezensionen sprechen für sich ...
https://www.amazon.de/Miracle-Love-Ram-Das/dp/1887474005
Warum ich maharaj-ji so oft hier bringe, ist ja hoffentlich klar, es ist das so
genannte "w.z.b.w.", also
was zu beweisen war
das Doppelspaltexperiment, das delayed Quantum Choice Eraser Experiment, thomas juffmanns "ONE by One" Experiment (Uni Wien), das ANU-Experiment von Prof. tuscott (2015 veröffentlicht), Effekte wie der der Tunneldiode zeigen uns ganz empirisch, dass wirklichkeit nicht "materieller" Grundlage sein kann. Klar, es wirkt materiell, fühlt sich so an - aber das tut es im Traum ja auch. Ist die Grundlage von wirklichkeit etwas, was im weitesten Sinne mit "Information" erstmal beschrieben werden kann - sind alle Beschränkungen der Materialität: hinfällig. Das bedeutet, es müsste hier im Grunde einfach alles möglich sein - selbst das, was sich nicht einmal mehr denken lässt (wie denn das nun "gehen" soll), und eben genau davon maharaj-ji Zeugnis ablegt.

w.z.b.w.

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
16.04.2025 n. Chr. 07.25 Uhr
Puh, muß erstmal aus dem Traum-Modus wieder heraus. Garnicht so einfach, erst dort eine ganze Weile gewesen zu sein, und dann wieder hier. Sonne satt, heute wohl den ganzen Tag, bei bis zu 24°C, Mitte April, holla.
Auch die Kunstwerke der Knospen des Blattkaktus kommen ordentlich voran, kein Wunder, bei den Temperaturen, wie Lichtverhältnissen ..
Hier jetzt langemann nochmal, nachdem er Chat GPT gefragt hatte, was diese als Teufel machen würde, um den Verstand der nächsten Generation zu zerstören, fragt er nun, was diese als gott machen würde, um das zu verhindern. Nun habe ich mir dort keine Kommentare bisher angeschaut, ist wohl auch fruchtlos, weil dort wohl keiner auf der Uhr hat, dass hinter einer KI eine enorme Unschärfe herrscht, und demgemäß der spielbetreiber selbst die antworten geben könnte - ohne dass jemand auf diese Idee jemals kommen könnte, dass das wahrlich die Worte gottes sind (oder gottes als Gegenstromanlage/satan)...

So genieße ich grad den Ausblick auf die satt grünen Elbwiesen, ganz klar - der April ist dieses Jahr der Wonnemonat. Wie schon geschrieben, ich kann mich nicht erinnern, jemals solch eine schöne Zeit beinahe "am Stück" in den Monaten März und April gehabt zu haben.
Gestern habe ich ja nurmal eine kleine Begebenheit im
Zusammenhang von "Wetter" und maharaj-ji gebracht (im Buch sind noch ein paar
mehr davon, also, was maharaj-ji so mit dem "Wetter" machen konnte), und auch
hier stellt sich letztlich heraus, auch unsere ganze Erklärungsmodelle des
"Wetters" mit "Hochs" und "Tiefs", den scheinbar resultierenden Winden und
Wolken und Regen und wasweißich - sind bloß die scheinphysischen
Plausibilitätsausreden, warum das Wetter so ist, wie es ist. Faktisch kann der
spielbetreiber, eben auch hier aus der enormen Unschärfe heraus, jegliches
"Wetter" implementieren, nur eben sollte es zur Jahreszeit passen, weil sonst
fällt's auf.
"The atoms did not travel from A to B.
It was only when they were measured at the end of the journey
that their wave-like or particle-like behavior was brought into existence"
Prof. tuscott, ANU Physics (Mai 2015)

Ja, diese göttliche wirklichkeit. Wie oft erwähnt, nach dem Doppelspalt- und Folgeexperimenten, nach welchen klar war, dass wir hier "im Innersten" einer Virtualität uns befinden - welche sich freilich hartnäckig "physisch" "echt" anfühlt, ist maharaj-ji einfach das Sahnehäubchen, der krönende Abschluss, welcher noch zur Abrundung des Gesamtbildes fehlte. Auch (oder vor Allem ?), weil durch ihnj auch der Charakter gottes durch scheint.
So, und ich setze mich jetzt auf den Balkon, besser war das Wetter noch nie dieses Jahr.
wirk
lich
keit

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
21.04.2025 n. Chr. 07.50 Uhr
"Der Begriff der Realität bezeichnet vom Standpunkt der
Wirklichkeit aus,
in ihrer modernen quantenphysikalischen Form, nur noch eine Als-ob-Beschreibung,
weil es in ihr ja im Grunde keine Teile und damit auch keine Dinge gibt."
hans-peter duerr (ehem. Leiter max planck Institut)/raimon
panikkar (Co-Autor)
"Liebe - Urquelle des Kosmos"
2 Monate noch, dann werden die Tage wieder kürzer. Wenn der Mai sich dem Ende neigt, ist auch Weihnachten nicht mehr weit. Insbesondere jetzt, da ich wieder mit den Motorrädern ein wenig mich beschäftige, merke ich noch stärker, wie die Zeit rennt. Gestern war hier der ganze Tag voll Sonne, nachdem der Frühnebel sich verzogen hatte, und gegen Abend saß ich dann wieder an meiner Mauer, in der Sonne, und las weiter, in "devine reality", also der göttlichen wirklichkeit.
Üblicherweise so in etwa 5 Seiten, was um die 8 kleine Begebenheiten rund um neem karoli baba entspricht. Wie schon so oft geschrieben, wenn "durch" mit den 5 Seiten, lege ich das Buch beiseite, und spüre wieder so richtig, dass ich mich hier in Takatukaland, einer Traumwirklichkeit befinde. Übrigens ist Traumwirklichkeit ein Pleonasmus, eine überflüssige Worthäufung, denn wie vor ein paar Tagen schon geschrieben, es heißt ja bereits wirk lich keit, und in dem "lich" steckt ja bereits die Traumartigkeit drin. Es ist hier nur so, als ob "wirk", als ob "materiell", als ob "kausal".
wirk lich
materielllich keit
kausallich keit
|
"Gleichzeitig fragte ich ihn aber auch, was er denn machen würde, wenn er am Ende tatsächlich auf dasselbe Ergebnis käme; er würde es, so sagte er, dennoch nicht glauben, denn was ich von mir geben würde, könne einfach nicht sein, da sonst die ganzen wissenschaftlichen Denkmodelle falsch wären ! Bei ihm stapelten sich die Bücher, und viele nahm er zur Hand, um mir meinen Irrtum deutlich zu machen. „Roland“, sagte er, „hier steht überall, daß das nicht sein kann, was du da machst !“
|
Übrigens rutscht das, was ich mit "Freigabeprinzip" seit geraumer Zeit nun schon benenne, immer mehr in die Ecke, welche z.B. in den Vorträgen von ram dass, den Podcasts von krishna das, aber auch anderen, mit "Gnade" oder eben "bliss" bezeichnet wird. Der Arbeitstitel ist dann
Du kannst nichts erlangen, nichts erreichen durch deinen
scheinbaren eigenen Willen
Es wird dir gegeben.
(durch Gnade/Freischaltung)
Also auf direktem Wege ist es nicht möglich, zu diesem oder jenem zu kommen. Stellt euch ein Videogame vor, in welchem hier vor ein er massiven verschlossenen Schatztruhe steht, und nun ein kleines Stemmeisen habt, mit welchem ihr versucht, die Truhe aufzubekommen. Ist nun die Qualität und Geometrie des Stemmeisens, eure Muskelkraft, die Solidität der Beschläge der Truhe dafür "kausal" verantwortlich zeichnend, dass ihr die Truhe aufbekommt, oder nicht ? Natürlich nicht, denn das ist ja alles nur scheinbar, nur so, als ob da ein Stemmeisen wäre, eine Schatztruhe. Ihr befindet euch ja nur in einer wirk lich keit, also einer Umgebung, in welcher es so scheint, als sei Muskelkraft, oder die Solidität und Beschaffenheit von Materialien entscheidend.
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
prof. tuscott, Australian national University, 27 mai 2015 - Link
Hier, der evan gefällt mir mit seinem "down to earth" charakter echt gut, er erwähnt auch die "Gegenstromanlage" ("against strong current"). So hätte ich zwar eher den Titel "wu-wei, stop forcing (and things unfold)" gewählt, mehr nicht, weil da jetzt in dem OEM-Titel eine Kausalität impliziert wird, also dann doch wieder, "wie man was erreichen kann". Doch egal, mir gefällt seine Unaffektiertheit, sprich Authentizität.

| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."
werner heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.
|
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
22.04.2025 n. Chr. 08.30 Uhr
Sonne !, kaum eine Wolke, etwas Wind geht, 17°C im Schatten sollen es werden, was will man mehr. Die natur "da draußen" ist nach den 2 Tagen mit einigermaßen Regen enorm dankbar, und geradezu am explodieren, der April ist , wie schon gesagt, diesmal der vorgezogene Wonnemonat. Hier, die letzten 3 Monate, man kann wohl nachvollziehen, wie sehr die Pflanzen den Regen benötigt haben.
In Hamburg ist es grad wärmer, als in Madrid, und das stelle ich jetzt schon seit ein paar Jahren fest - die Spanienurlauber, welche das Frühjahr in Spanien nutzen wollen, um sich schon aufzuwärmen, haben die letzten Jahre eben zumeist mit Rosinen gehandelt, von der Großwetterlage her scheint sich da wirklich etwas zu ändern, die alten Regeln scheinen nicht mehr ganz so zu gelten. Letztes Jahr war es in im Süden von Skandinavien oft wärmer, als in Spanien.
Das "Schöne" ist, dass die Meteorologen immer Gründe finden werden, warum das Wetter so ist, wie es ist, und für uns demgemäß das "Wetter da draußen" immer plausibel erscheint, ja wegen der Hochs, und der Tiefs, oder weil die Wälder abgeholzt werden, der kosmischen Strahlung oder sonstwas. So viel Unschärfe ist jedoch im "Wetter", dass hier im Grunde letztlich beinahe jegliches Wetter hinplausibilisiert werden kann, selbst wenn hier einmal Orangen wachsen werden, wie es alois irlmaier gesehen hat, wird es so sein - die "Meteorologen" werden es schon passend erklären.
Dann gibt es ein weiteres Buch von einem langjährigen Devotee von maharaj ji, über maharaj ji, nämlich von dada mukherjee.
https://medium.com/@mysticzippy/the-guru-and-the-disciple-dfca8fafaae9
Es trägt den Titel "the near and the dear", welches auch Spitzenrezensionen hat, doch im Augenblick ist auf die Schnelle nur ein Exemplar für 100 Euro erhältlich, was mir grad etwas zuviel ist. Aus den USA ist man mit Versand und Zoll noch etwas günstiger. Klar, per Kindle ist es günstig, aber ich will ein Buch in den Händen halten, wenn ich in der Sonne sitze, und dann sogar ohne Brille lesen kann, und halt nicht wieder auf eine Glotze starren, oder Papierfetzen in den Händen halten.
https://www.amazon.de/Near-Dear-dada-mukerjee/dp/1887474021
Und deswegen beende ich jetzt hier den Blog, und mache mich auf die Suche, ich "will" dieses Buch jetzt haben. An das Buch "devine Reality" von rajida war da weit einfacher heran zu kommen ...


| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."
werner heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.
|
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
23.04.2025 n. Chr. 08.19 Uhr
"Der Begriff der Realität bezeichnet vom Standpunkt der
Wirklichkeit aus,
in ihrer modernen quantenphysikalischen Form, nur noch eine Als-ob-Beschreibung,
weil es in ihr ja im Grunde keine Teile und damit auch keine Dinge gibt."
hans-peter duerr (ehem. Leiter max planck Institut)/raimon
panikkar (Co-Autor)
"Liebe - Urquelle des Kosmos"
wirk
lich (angelehnt an, ausgestattet mit Zügen von, in gewisser Analogie)
keit
Sonne satt, wenn wohl auch nur bis etwa Mittag - mal schaun. Der Blattkaktus steht jetzt draußen, zur Sonne gewandt.
So kann ich jetzt zwar die herrlichen Blüten nicht mehr direkt von vorne sehen, aber dafür hat's der Kaktus gut, und mit Glück gibt es durch die Bestäubung ein paar Früchte, welche sehr exotisch uns lecker sind.
maharj-ji, Begebenheit No. 198, erzählt vom Onkel des Verfassers des Buches devine Reality (rajida)
Wenn das so weiter geht, landen bald alle Beiträge hier in der Rubrik "physisch ist [genau]: garnichts", was aber mehr oder minder nur zwangsläufig sich ergibt, wenn man sich intensiv mit demjenigen beschäftigt, was so rund um maharaj ji vorgefallen ist.
"die lilas fielen von ihm herab, wie Blätter von einem
Baum"
krishna das
"lila" bedeutet hier im Westen mehr so etwas wie "Wunder", während es im Hinduismus eher mit "göttliches Spiel" beschrieben wird.
Im Grunde müsste man ja jede in dem Buch niedergeschriebene Begebenheit um Maharaj ji mit einem "Incoming" versehen, doch um nicht inflationär zu werden, benutze ich das "Prädikat" für die einzelnen Erzählungen doch eher selten. Und gestern war es mir dann doch scheißegal, also "the near an the dear" (Link) von dada mukerjee gekauft, wo ich dann schon dabei war, auch ein weiteres Buch von ihm über maharaj ji (by his grace).
Das ist für mich so, als hätte etwa matthäus ein Buch geschrieben, über seine Erlebnisse mit jesus. Und im Falle von krishna das, welcher ebenfalls ein Buch über maharaj ji und die Erlebnisse rund um ihn herum geschrieben hat, ist es für mich so, als ob man einem Matthäus noch "lebend" (hier im online Game) lauschen könnte. Wann hat man schonmal solch eine Gelegenheit ? Alle paar tausend virtuellen Jahre ?
Morgen gibt es eine "incoming" Begebenheit, die ich nur deswegen so auszeichne, weil ich die einfach besonders lustig finde, und aufschlussreich (Unschärfeprinzip. Das fällt nämlich bei allen Begebenheiten auf, wie eben maharaj ji die Unschärfe nutz, um keine Wellen zu schlagen. So hatte er etwa einem Mädchen versprochen, welches ihre gesamte Familie verloren hatte, von nun an ihr Vater zu sein, und 17 Jahre lang, bis zu seiner Abreise, besuchte er sie jedes Jahr zu einem besonderen Familien(feier)tag in Indien. Sie wohnte weiter weg, doch 11 Jahre davon war er bei ihr, aber auch im Tempel. Also "doppelt vorhanden", das nennt man in der Fachsprache "Bilokalisation", nur, das Unschärfeprinzip besagt ja, "kann man wissen?", und da niemand anwesend war, kein "Messgerät", welches wusste, dass maharaji ji jetzt zur gleichen Zeit an zwei Orten ist (manchmal auch 3), herrscht enorme Unschärfe, es werden "keine Wellen geschlagen", die Konsistenz der wirklichkeit hier nicht verletzt (erstmal). Da hab ich übrigens noch eine schöne Begebenheit, die kommt dann vielleicht übermorgen (wenn ich dran denke). Gestern habe ich etwa 8 Erzählungen gelesen, am liebsten würde ich die alle hier heute jetzt bringen ...
Wie schon gesagt von krishna das - ausreichen würde auch eine einzige davon, um glasklar im virtuellen Schädel zu werden, dass wir es hier tatsächlich, expressis verbis, mit einer wirk lich keit zu tun haben, also einer Einrichtung (-heit, -keit), welche in gewisser Analogie (-lich) zu wirk, zu wirkend, zu "Kausalität" steht, "materiell" also uns erscheint, doch faktisch eben nicht ist, wie kindlich nicht kind ist, nicht kind bedeutet. Doch mir geht es ja schon lange ! nicht mehr darum, "lilas sind für Kinder", wie maharaj ji mal sagte, sondern, ich erfahre letztlich über diese vielen kleinen und größeren Begebenheiten, und wie sie verliefen, welcher Charakter ihnen anhaftet, auch eben ein wenig mehr über den Charakter gottes, sozusagen.

"The atoms did not travel from A to B.
It was only when they were measured at the end of the journey
that their wave-like or particle-like behavior was brought into existence," he
said.
prof. tuscott, Australian national University, 27 mai 2015 - Link
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
24.04.2025 n. Chr. 07.44 Uhr
"Es gab eine Zeit, als Zeitungen sagten, nur zwölf Menschen
verständen die Relativitätstheorie.
Ich glaube nicht, dass es jemals eine solche Zeit gab.
Auf der anderen Seite denke ich, es ist sicher zu sagen, niemand versteht
Quantenmechanik."
richard feynman, The Character of Physical Law, MIT-Press 1967, Kapitel 6
Sonne ! ... noch.
Aber das war gestern schon klar, heute wird ein "drinne" Tag, freu' mich auch schon, denn ich habe etwas Spezielles vor, was ich schon vor 16 Jahren am Motorrad machen wollte, nur aus Zeitgründen nicht geschafft habe. Und gestern ist mir noch eingefallen, dass diese Bücher "Miracle of love" von ram dass, "devine reality" von rajida, "the near and the dear" von dada mukerjee, wie auch "love everyone" von parvati markus (kürzlich herausgekommen) so etwas sind wie die einzelnen Bücher, welche dann das neue Testament formten. So das neue Testament ja auch nicht mehr macht, als die Begebenheiten rund um jesus wieder zu geben, seine Worte, sein Wirken. Und so die vorgenannten Bücher es machen - nichts weiter niedergeschrieben und somit festgehalten haben, als was sich so rund um neem karoli baba ereignet hat. Nun, hier sind im Gegensatz zum neuen Testament die Worte bei weitem nicht so reichhaltig, mehr als "liebe jeden, ernähre jeden, erinnere gott und rede die Wahrheit" war von maharaj ji ja kaum zu hören, doch dafür waren die Taten, die non-verbalen Geschehnisse um so reichhaltiger.
Zum Autor des Buches: parvati markus hatte ja raghu markus bei neem karoli baba kennen gelernt (~ 1970), und soweit ich noch weiß, hatte er die beiden auch verheiratet.
https://www.amazon.de/Love-Everyone-Transcendent-Westerners-Transformed/dp/0062342991
So, jetzt zwinge ich mich aber nochmal kurz, nach "draußen", auf die Bühne zu schauen, was da so wieder, oder scheinbar los ist.
Also ?
Genau ...

6500 Jahre Sozialismus, von igor schafarewitsch nachgewiesen, ziehen sich durch die virtuelle Historie, und daran wird sich wohl auch nichts ändern, denn das ist nunmal der Arbeitstitel dieser wirklichkeit.
"Deal with it"
that's the Name of the Game
tom campbell
""Komm' damit klar", das ist der Name des Spieles", was dann auch ein klarer Hinweis darauf ist, dass den Player hier halt immer wieder was "Neues" aufgetischt wird, womit sie zurechtkommen müssen. Und damit sind eben nicht gebratene Hähnchen oder Veggie-Burger gemeint, die durch die Luft fliegen. So ist das hier, man muß halt mit demjenigen zurecht kommen, was einem so aufgetischt wird. Und da das eben der Arbeitstitel ist (yaldabaoth, satan, Gegenstromanlage, Sozialismus, "Materie"), ist es unwahrscheinlich, dass sich daran etwas ändert. Es ist hier nunmal das Kind der sophia (yaldabaoth), sie - ein Äon - hat sich dieses 3-D gefühlsechte spiel ausgedacht, laut Nag Hammadi, nur eben: ohne gott einzubeziehen bei der Entwicklung des spieles. Deswegen er ja meinte: "du hast ein Monster erschaffen, ich werde es im Auge behalten", so jedenfalls noch meine Erinnerung. Und das Monster bleibt eben das Monster, es ist ja, gottseidank, dann am langen Ende nicht das gewesen, als was es sich angefühlt hat, wie eben auch der anstrengendste Traum irgendwann sein Ende findet.
Ja, die "Truthernews" erspare ich euch, die sind nämlich, formal gesehen, ganz nahe bei den Mainstream-"News", soll heißen, auch hier dreht sich alles nur im Kreise. Nicht, dass sich nun garnichts "tut", aber es ist halt alles so quälend langsam, dass man schon ein paar Jahrzehnte zurück schauen muss, um feststellen zu können, dass sich tatsächlich Wesentliches geändert hat. So von Woche zu Woche bemerkt man das nicht, es braucht schon ausgedehntere Zeitperioden. Daher es reichen dürfte - wenn überhaupt - sich die Schlagzeilen der MSM wie der AMSM ("alternativen" Mainstream-Medien, auch "Trutherszene" genannt) vielleicht alle 3 Monate mal anzuschauen. Die Truther-Folge "Geht's los ?" ist jetzt schon bei Nummer 1116. Wie schonmal geschrieben, ich bin schon super gespannt auf Folge 111600 ...

Doch vielleicht haben wir ja doch Glück, und gott hat mit uns Erbarmen, und lässt mal - wenn auch nur kurzzeitig - etwas anderes, als das Übliche hier zu ? Das mal irgendwie frischer Wind in die Bude kommt ?
Mal schaun, hier jetzt jedenfalls etwas Aufheiterndes :-)


"The atoms did not travel from A to B.
It was only when they were measured at the end of the journey
that their wave-like or particle-like behavior was brought into existence," he
said.
prof. tuscott, Australian national University, 27 mai 2015 - Link
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
25.04.2025 n. Chr. 08.36 Uhr
Gestern war das Wetter hier dann doch bedeutend besser, als vorher gesagt, dafür es eben heute "schlechter" bleiben wird, als es noch gestern prognostiziert wurde. Der träume wieder reichhaltig, sie wirken - bis auf den etwas phantastischen Ablauf - wie ein normales leben, mit ganz gewöhnlichen Problemen, Aufgabenstellungen, Ärgernissen, Freuden, Enttäuschungen und so weiter. Doch wie wir ja wissen, bestehen ja der normale "Alltag", wie auch der so genannte Traum, aus ein- und demselben Zeugs, nämlich: Information. Daher diese beiden nicht wirklich verschieden sind, und nur durch eine Art Illusion mehr oder minder scharf von einander abgegrenzt erscheinen.

Tatsächlich der Traum der echtere Zustand ist, da er dem wahren Wesen von Bewusstheit näher kommt, als dasjenige Phänomen, welches wir das gewöhnliche leben nennen. Im Traum so auch die Limitationen viel geringer sind, was so "sein" und "geschehen" kann - hier also die eigentliche natur von information, also ihre eigentliche Unbegrenztheit des Möglichen, viel mehr zum Ausdruck kommt. Im Alltagsleben scheint ja alles "materiell limitiert" zu sein, was natürlich eine beinahe vollkommene Illusion ist.
Die die scheinbar "materielle" Limitiertheit, welche wir im Alltag zu jeder Sekunde spüren, ist letztlich ein perfekter Trick. Dinge wirken schwer, undurchdringlich, träge, alles braucht seine Zeit, auch um von A nach B zu kommen, den kleinen Zeh am, Tischbein gestoßen hat man auch noch Schmerzen den halben Tag, von anderen Nöten, welche sich einfach an die Körperlichkeit anschließen, ganz zu schweigen. Atme, und dann hast du noch ein ganzes Bündel anderer, aber dennoch nur scheinbarer Notwendigkeiten an der Backe.
Doch es bleibt dabei, auch wenn dasjenige, was wir "leben" nennen, in der "Welt", eine wirklich totale Illusion ist, so ist sie dennoch keine sinnlose. Sie hat schon ihren Sinn und Zweck, und möchte auch, dass wir an ihr teilnehmen, wie Schauspieler an einem Bühnenstück. Daher eben auch der total zurückgezogene Weg so mancher Sadhus, Gurus, Yogis nur für ganz wenige "passt". Sie sind zwar irgendwie auf der Bühne, doch eben am Stück von Anfang an bis zum Ende keine Teilnahme haben, oder jedenfalls äußerlich nicht zu haben scheinen. Die Yogis also, welche wir der Möglichkeit nach kennen lernen können, demnach schon an der Aufführung hier Teil nehmen, sonst wir ja nie von ihnen Kenntnis erlangen könnten. Bis auf also ganz wenige Ausnahmen alle hier auf ihre Art teilnehmen, mehr oder minder stark in "Materie", in "Weltlichkeit" verfangen. Es kommt halt immer darauf an, wie sehr man das Bühnenstück mit dem Echten verwechselt. Viele sind so tief drin im "Stück", dass sie überhaupt nicht wahrnehmen, dass es bloß eine Rolle ist, welche sie sich entschieden haben, mal zu spielen.

Daher ja auch meine nun öfter wiederholte Einstellung zu dem Ganzen hier, nämlich, dass man das lamentieren darüber sein lassen kann (und sollte), wie wirklichkeit grad beschaffen ist, oder auch einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach beschaffen sein wird. Weil, indem man lamentiert, man einfach vergisst, dass das der Charakter dieses Bühnenstückes ist: fordernd zu sein für nahezu jeden.
Das ist der Titel dieses Spieles: "komm' damit klar"
tom campbell
Wenn alles immer, also ohne Unterlass, fordernd ist, verliert man natürlich auch die Lust, noch mitzumachen, also besteht hier alles aus einem gesunden Mix, von fordern und Erholen, und man ist gut beraten, die Erholungszeit auch als solche zu nutzen. Wie ein Sportler, welcher weiß, dass die nächste Herausforderung nicht weit entfernt ist. Und was ja das Gute an dem Ganzen ist: es geht ja nicht für ewig so weiter.
Heute werde ich aus dem Zentralgefängnis entlassen
maharaj ji am Tag seines Mahasamadhi frohlockte
So jim carrey (2-facher, fraktaler Schauspieler) es jedem wünscht, ganz ganz reich, und ganz ganz berühmt zu werden, weil er dann die Chance hat, live zu erleben, dass das überhaupt nicht der Sinn der ganzen Unternehmung hier ist.

"The atoms did not travel from A to B.
It was only when they were measured at the end of the journey
that their wave-like or particle-like behavior was brought into existence," he
said.
prof. tuscott, Australian national University, 27 mai 2015 - Link
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
25.04.2025 n. Chr. 07.36 Uhr
Sonne satt, beinahe windstill
Und so richtig ändern soll sich die nächste Zeit daran auch nicht.
So viel Sonne bereits im März und April, bei gemäßigten Temperaturen, es bleibt dabei, ich bleibe dabei - ich kann mich nicht erinnern, jemals diese Monate mit solch einem recht beständig gemäßigten, gutem Wetter erlebt zu haben. Was allerdings schon seit Jahren sich relativ gleich bleibt, ist der wenige Regen. Die Schwertlilien oben bei thomas schaffen es seit Jahren nur zum Blattwerk, aber nicht zur Blüte, einfach, weil es zu trocken ist. Hier mehr Nordosten, die Niederschlagsmenge über ein Jahr, man achte auf die Skala
Und hier der Südwesten (auf die Skala achten !)
Doch als ich hierher gezogen bin, und erst einmal alles erfahren wollte, wurde mir auch gesagt, dass das hier die regenärmste Region von Deutschland sein soll. Grad nachgeschaut:
Bei 3-wetter-Taft hieß es ja in der Werbung "Hamburg, wieder mal Regen", und als ich dann hierher zog, fiel es dann irgendwann schon auf, wie wenig es regnet. Die Landwirtschaft jedenfalls mit diesen Wetterbedingungen vertraut ist. Und wie das Wetter, so die wirklichkeit, hier so, woanders halt etwas anders, Die einen liegen am Strand und bräunen sich, und ein paar Kilometer weiter die anderen in einer Zeltstadt von Panzern und Flugzeugen aus bombardiert werden. wirklichkeit und Wetter vieles gemeinsam haben. Diese gewaltigen Unterschiede auf ein- und demselben Spielbrett, wie es scheint. Doch es eben dieses im Sinne von "Existenz" natürlich nicht gibt, also eine wirklichkeit "da draußen", welche auch unabhängig von Bewusstheit "da wäre".
Weil eben letztlich wirklichkeit für jeden einzelnen ein Strom von daten ist, deren teilweise scheinbare Übereinstimmung wir "Objektivität" nennen, kommen wir eben auf die Idee, dass eben dieses Übereinstimmende der daten auch so noch einmal "in echt", "da draußen" "existiert", was aber Blödsinn ist, es gibt dieses "da draußen" nur in einer Art und Weise, wie es etwa auf dem Holodeck bei der Enterprise "existiert"
| "Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. [...] Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."
heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.
|
Und wir uns gewöhnt haben daran, dass das wettere mal so, mal wieder anders ist, und wir darauf mit passenden Klamotten und verschiedener Art von Aktivität reagieren, so sollten wir auch die restliche wirklichkeit auffassen, und eben möglichst wenig lamentieren. Das ist zumeist natürlich ein frommer Wunsch, weil wirklichkeit ja geradezu darauf "designed" ist, dich zu nerven, dir auf die Pelle zu rücken, und man sich hier einfach kein Dach bauen kann, welches dann vor Regen schützt, sondern wirklichkeit sucht dich auf, wo immer du auch bist. Zur Not von innen, als Krankheit oder sonst eine Kalamität. Der Körper ist das "Zentralgefängnis", wie es maharaj ji am Tag des mahasamadhi beschrub.
Nur wahrscheinlich braucht es einen recht hohen Grad an "Realisation", um das so wahrnehmen zu können, dass also unsere so genannten "Probleme" letztlich dadurch beginnen, und am leben gehalten werden, dass wir atmen. Hört man auf, zu atmen, hören bei den Allerallermeisten auch die Kalamitäten auf. Weil man dann aufwacht, und siehe "ah, oh", der (Alb-) Traum ist vorbei. Nur, wie schon gesagt, wir sind ja hier, um zu partizipieren, am Stück Teil zu nehmen, uns auch nerven, aufregen und ängstigen zu lassen, weil dadurch eben die Erfahrungen zu Stande kommen, welche wir anscheinend benötigen. Stellt euch eine Friede-Freude-Eierkuchenwelt vor. Nur kurz würden wir diese "genießen" können, doch bald schon ginge es los, dass wir uns und oft auch den anderen das leben von ganz allein wieder "schwer" machen. Und woran liegt das ?Es liegt daran, dass es faktisch ein Spiel hier ist, ein Lern- und Entwicklungsspiel. Schon bei den tieren wird dieses spielerische Element auch "Schule" genannt, "spielen" und dazu-lernen hängen unzertrennlich zusammen.

Deswegen es im Hinduismus mit dem "lila" auch "nur" ein sozusagen göttliches Spiel ist. Im Grunde doch eine segensreiche Einrichtung, dass uns dann doch gezeigt wird (wenn auch recht versteckt), dass wir hier es keineswegs mit einem "echten Monster" (yaldabaoth, Nag Hammadi) zu tun haben. Nur, es ist halt so versteckt, dass man schon ordentlich Hartnäckigkeit an den Tag legen muss ...

"The atoms did not travel from A to B.
It was only when they were measured at the end of the journey
that their wave-like or particle-like behavior was brought into existence," he
said.
prof. tuscott, Australian national University, 27 mai 2015 - Link
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
27.04.2025 n. Chr. 09.09 Uhr
In Göteborg grad wärmer als in Madrid, aber egal - Sonne satt
:-)
Zu spät dran, morgen dann wieder.

"It proves that measurement is everything. At the quantum
level,
reality does not exist if you are not looking at it."
"The atoms did not travel from A to B.
It was only when they were measured at the end of the journey
that their wave-like or particle-like behavior was brought into existence."
prof. tuscott, Australian national University, 27 mai 2015 -Link
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
28.04.2025 n. Chr. 07.11 Uhr
"It proves that measurement is everything. At the quantum level,
reality does not exist if you are not looking at it."
prof. tuscot, Australian National University (link)
Blitzeblau der Himmel, und die natur ist explodiert, sozusagen. Alles satt grün, nur die Elbwiesen, welche von keiner Seite beschattet werden, haben schon ein wenig ihren satten grünen Ton verloren, was sich gut sehen lässt im Vergleich mit der Nordseite des Deiches, wo das Gras zumeist im Schatten ist. Etwas meinungslos bin ich gerade, genieße einfach den Anblick. 26 Minuten haben jetzt diese 2 Sätze gebraucht, da kann man mal sehen, wie schnell doch die Zeit vergeht, wenn man einfach relativ gedankenverloren aus dem Fenster schaut.
Und hier, etwas zum "Hereinkommen".
Ein Staatssekretär weiß, dass er mit seiner Familie zu spät zum
darshan (Beisammensein) kommen wird, und weiß aber auch, wohin maharaj ji fahren
wird. So parkt er das Auto in einer Strassenbiegung, um maharaj ji "abzufangen".
Als maharaj ji dann losfahren will, weißt dada (mukerjee) ihn darauf hin, dass
ambatt pande noch nicht angekommen ist, und ihn wohl an der besagten Stelle
"abfangen" wird, doch baba antwortet: "heute gibt es kein darshan".
Und wie löst man das Problem also elegant, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen
?
Lest selbst ...
Realität kann also sogar selbst dann nicht existieren, wenn man hinschaut ...
Woraus bestand "das Auto" ?
Aus Atomen ?
"The atoms did not travel from A to B.
It was only when they were measured at the end of the journey
that their wave-like or particle-like behavior was brought into existence," he
said.
prof. tuscott, Australian national University, 27 mai 2015 - Link
Und hier, immer wieder Sonntags, evan, hörenswert ! Zitiert auch ramana maharshi :-)

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
11.05.2025 n. Chr. 07.05 Uhr

Heute gibt es ein incoming auf Deutsch, in "Spielfilmqualität", das heiß, wie die Fräser sagen "fertige arbeit", da brauche ich dann selbst nicht mehr viel zu tippen. Passt auch recht gut, denn mir fällt auch im Moment wenig ein. Zur heutigen Doku, die ist ganz ähnlich den Büchern von ram dass, rajida, dada mukerjee und anderen über maharaj ji, nämlich, was grete häusler in ihrem leben mit bruno gröning so alles erlebt hat. Sozusagen aus "erster Hand". Da kommen noch Eigenschaften von bruno hervor, welche mit der Fähigkeit zu heilen nichts mehr zu tun haben, und auch in die Richtung gehen, was über maharaj ji berichtet wird, welcher zwar auch heilen konnte, bis zur auferstehjung vom "Tode", doch eben dieses nicht der Schwerpunkt war.
Doch einen habe ich hier vorab noch, ist zwar, wie im Grunde jede Begebenheit, ein "incoming", aber ich denke, wer länger auf diesem Blog hier ist, dem ist klar, dass er sich hier in einer virtuellen Lern- und Entwicklungsumgebung befindet, in welcher - da auf information basierend - einfach alles möglich ist. Und das: problemlos. Hier, was Lustiges.

K
lar, gegenwärtig haben wir grad die Spieloberfläche "da draußen", die wir nunmal haben. Wo es früher Namen wie "Cäsar" oder "Ludwig der soundsovielte" gab, haben wir heute andere Namen, welche in dieser gegenwärtigen wirklichkeit für gewisse Entwicklungen verantwortlich zu zeichnen scheinen. Sei es nun auf der ersten, offensichtlichen ebene des Mainstreams, oder für die "Truther" noch ein- zwei oder gar mehr Ebenen dahinter. Doch letztlich die Meisten aus der Szene physische Adressaten ausfindig machen, und diejenigen, welche dann ein nicht irdisches Prinzip, oder "wesenheit" in Anschlag bringen, benennen es meist mit "satan" oder ähnlich. Für alle dazwischen, die sich nicht entscheiden können, sind es dann so Zwittergeschichten, wie "Archonten" und all sowas, halt weder Fisch noch Fleisch. Dass dieses Bedrückende, Nervende, Krankmachende, scheinbar Ungerechte und schließlich Tödliche hier auch aus gott stammt, damit tun sich die Allermeisten äußerst schwer. Im Westen zumindest, woanders sieht es schon ganz anders aus.
So habe ich ja auch meine "Probleme", mal im kleineren, mal im größeren Umfange, doch mittlerweile sage ich mir: "ok, da musst du jetzt einfach durch", und man versucht, das Beste daraus zu machen, also entweder die Lösung mit der geringsten Unordnung zu suchen, oder gemäß den wu-wei Prinzip noch etwas spielerischer zu nehmen, und Dinge laufen zu lassen, nicht zu versuchen, sie zu seinen Gunsten zu biegen, wie es maharaj ji immer anempfiehlt. So jedenfalls hatte es therese neumann immer gesehen, immer betont, und auch gelebt - sie mußte ja so richtig was durchmachen, doch hat es immer genommen, als ob es halt so sein müsste, und somit ihr (gewählter) Weg sei. Was den Schriften und Bilddokumenten nach therese ausgehalten hat, liegt wahrscheinlich jenseits der Vorstellungskraft der Meisten, doch hat sie ihre schmerzen und Leiden mit einer gewissen Gleichmut getragen. Es war so "dolle", dass sie sagte, wenn sie gewusst hätte, wie lange sie diese Zustände wird erleben müssen, sie nicht hätte leben wollen. Dass paramahansa yogananda bei seiner Rückkehr aus den USA nach Indien nochmal einen Zwischenstopp bei therese in Konnersreuth machte, beleuchtet ein wenig, was für eine Ausnahmestellung therese hier hatte.

Da hatte es jesus noch vergleichsweise "gut", und musste "physische" Schmerzen nicht so gefühlt ewig lange durchmachen, wie therese. Wiewohl den Zeugnissen von therese neumann nach, jesus auch am Kreuz keine Schmerzen gehabt haben soll. So war ja therese fast jeden Donnerstag bis Freitag Nachmittag (Gründonnerstag-Karfreitag/Kreuzigung) therese "dabei", und sie sagt, dass jesus, als die Nägel durch die Füße getrieben wurde, nur sagte "hau fester", was so in etwa dem Humor eines maharaj ji entspricht und jedenfalls nicht hindeutet auf irdische Schmerzen.
So, und wo wir schon dabei sind, voila !, bruno gröing ...



|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
11.05.2025 n. Chr. 06.51 Uhr
Gestern 23.20 Uhr, war es in Bremen wärmer als in Lissabon, in Köln wärmer, als in Algier (Afrika)...
Die weiteren Aussichten (Stand: gestern 23.20 Uhr)
Heute gegen 13 Uhr, Stuttgart wärmer, als Madrid ...
Vorhersage für Morgen.
Und übermorgen (Stand: gestern 23.20 Uhr)
Die letzten Jahre habe ich mit einigen menschen gesprochen, welche selbst oder in ihrem Umfeld über Erfahrungen mit dem "urlaub in Spanien" verfügen, und seit ein paar Jahren ist die Regel, dass es dort früher und zuverlässig wärmer ist, als in hiesigen Gefilden, irgendwie durchbrochen. Es scheint, als würde hie und da ein wenig "geschraubt" werden. der Trick bei dieser liegt ja auch darin, dass alles am Ende dann irgendwie plausibel bleibt, und wenn dann irgendwann in Bayern Zitronen und Orangen wachsen, wie irlmaier sagte, werden es alle normal finden, so gemächlich geht es zu.
http://www.alois-irlmaier.de/Neue%20Recherchen.htm
Sollte es dann so kommen, werden Meteorologen schon Gründe finden, warum das so ist. So ist ja diese wirklichkeit aufgebaut, es findet sich beinahe immer ein Grund, warum es so ist, wie es ist - solange man nicht zu tief gräbt.
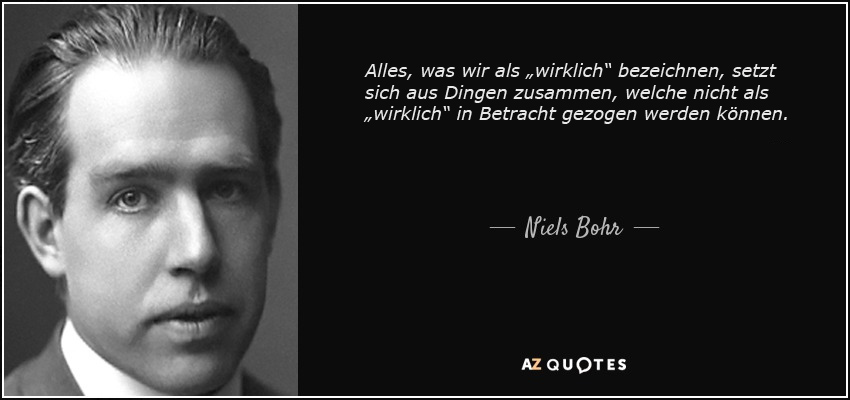
Macht man nämlich weiter, und bleibt nicht, wie die "Wissenschaften", an der Oberfläche stehen, löst sich so nach und nach die "physische" Begründbarkeit des zu erklärenden Phänomens auf. Was uns so solide erscheint, besteht faktisch nicht aus "Solidem", sondern aus einen gänzlich anderen "Zeugs", nämlich: information.
"Wir müssen davon ausgehen, dass auch "Vergangenheit" so etwas, wie eine Datei ist"
john archibald wheeler, einsteins letzter Schüler
Doch klar, letzten Endes ist es dann erstmal egal, wie sich wirklichkeit generiert. Ob sie nun "hier" geschieht, wie es auf den ersten Blick scheint, oder faktisch woanders (in other, edward fredkin), ist ja für unser tägliches leben vollkommen nebensächlich. Oder sagen wir es so - es scheint nebensächlich zu sein. Denn wenn man sich erstmal hinein vertieft, wächst eben Stück für Stück das Wissen darum, dass wirklichkeit völlig anders sich aufbaut, als es einem vorkommt, und auch in "Schulen", "Universitäten" geleert wird - und damit sich dann auch eine Art Wissen etabliert, dass hier letztlich selbst das Undenkbare möglich ist. Und zwar problemlos, da wirklichkeit halt aus information sich generiert, faktisch somit "woanders" gerendert wird. Nur wir erleben diese information halt als
jetzt
und
hier
Natürlich, vom theoretischen Wissen, bis zu dem Punkt, dass man diese "göttliche wirklichkeit" auch ein wenig als solche spürt, also dass man irgendwie in einem größeren "Videogame" eingebunden ist, das dauert ein wenig, das geht nicht von heut auf morgen. Was aber auch damit einher geht, ist, dass es dann ein wesen, eine Instanz geben muß, "auf welchem" oder besser in welchem das Ganze, was wir als "hier" erleben, vor sich geht.
max planck über dieses Eigenschaft von wirklichkeit, und was sie eben mit sich bringt ...
In gewissem Sinne bleibt also Alles erstmal äußerlich gleich, egal nun, ob du es weißt, oder es dir gar offenbart wurde, oder nicht.
Vor der Erleuchtung hackst du Holz und schöpfst Wasser
und
nach der Erleuchtung hackst du Holz und schöpfst Wasser
Im Äußerlichen ändert sich garnichts. Die Freuden, aber auch Leiden, Mühen, Plagen und Zweifel sind dieselben, wie vorher, doch im Innerlichen hat sich etwas getan, man begreift das Ganze von einer anderen Warte aus, sieht es als etwas, was nicht wirklich zufällig so ist, wie es ist. Und anscheinend, inklusive der Probleme und Widrigkeiten - als zugeschnitten auf einen selbst, wie ein Anzug auf Maß. Und bei dem "Warum das Ganze", bleibt dann nur noch übrig: um zu lernen.

Tja, und da passt es gut, dass tom campbell jetzt ein Interview gemacht hat über unsere Beziehung zu diesem "Größeren", was diese wirklichkeit letztlich generiert, und in welchem es faktisch "Statt finden" muß. Vor 2 Stunden veröffentlicht, du und deine Beziehung zu gott (im spiel hier)
Ein "Incoming" ?
Hab's grad erst entdeckt ...



|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
15.05.2025 n. Chr. 08.30 Uhr
Spät dran, daher nur etwas blabla. Während die letzten ~ 8 Tage ein deutlich wahrnehmbares Flugaufkommen herrschte, ist heute der Himmel wieder gänzlich ohne, bisher, das verstehe, wer will. Warum das Luftverkehrsaufkommen so dermaßen unregelmäßig ist, bleibt mir ein Rätsel, und ich habe dieses Phänomen schon seit längerem unter "reality Breakdown" eingeordnet. Was interessant ist, ich konnte mich die letzten, auch so 7-8 Tage nicht an meine Träume erinnern, obwohl es einen Anklang gab, dass es der übliche Marathon war. Doch heute kann ich mich wieder an viele Sequenzen aus den Träumen erinnern - doch einen Zusammenhang sehe ich da nicht ("Physisches" kommt ja bei mir eh nicht mehr in die Tüte zur "Erklärung"). Egal, so ist eben Wetter ein Teil der wirklichkeit, welche - wenn man sich mal klar wird, dass eben auch diese nicht "physisch" ist - einfach an sich unergründlich sein dürfte. Denn faktisch, im Sinne von "Geschehen", geschieht sie ja nicht "hier", sonder "in other" (edward fredkin), also woanders. Diese von uns hier erlebte wirklichkeit rendert sich nicht selbst. Was wir hier sehen, hören, riechen, generell erleben, ist sozusagen eine Verdolmetschung des zu Grunde liegenden in eine 3D-Version, mit welcher wir etwas anfangen können.

Die keinesfalls kontinuierliche, sondern diskrete Grundlage von wirklichkeit ist als solche von unserer Warte aus ja garnicht zu verstehen. Aus solchem Kauderwelsch sind jedenfalls wir nicht in der Lage, information so mal eben zu gewinnen.

So ohne den "Verdolmetscher", den Editor ja diese Webseite in der ersten ! dahinter liegenden Ebene ja nur html-Code "ist"

Tiefer "im Rechner" ist dieser html-Code wieder etwas ganz anderes, man wird da z.B. keine Buchstaben finden, keine Farben und im Grunde auch nichtmal Null oder Eins, sondern nur eine Abgrenzung, Etwas, und "Nicht-Etwas". Der Einfachheit halber fassen wir die Letzteren als Null und Eins auf. Interessanterweise ist es die Abgrenzung, welche eben auch die "Null" erst zur Information macht. Die Abgrenzung ist also das transzendentale Phänomen in kantischer Formulierung, also die Bedingung der Möglichkeit von information. Ohne Abgrenzung keine information. Deswegen man Urteilskraft auch Unterscheidungsvermögen nennt.
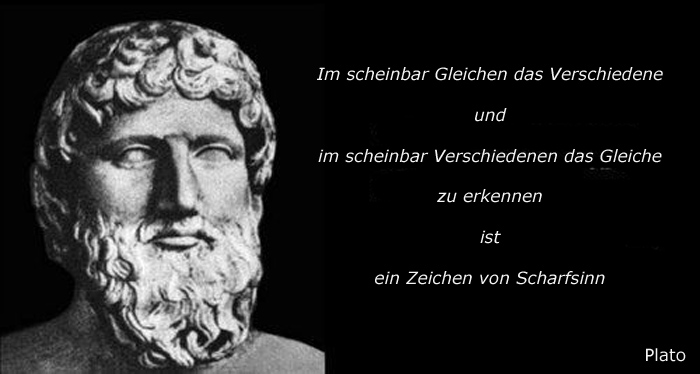
So, jetzt ist unten die Sonne rumgekommen, bis morgen.


18.05.2025 n. Chr. 07.49 Uhr
Hier, dieses Plakat hatte 2010 die Iowa-Teaparty in Mason-City auf die Werbetafel kleben lassen, aber einigen Mitgliedern war das dann "zu dolle", und man meinte, dass man in der Idee, den Sozialismus den menschen zu offenbaren, vielleicht ein wenig zu weit gegangen sei. Darüber kann man streiten, denn es heißt ja: wehret den Anfängen.
Quelle: https://www.nbcnews.com/id/wbna38244427
Im Februar/März hatte ich dieses Photo gemacht, der Apfelbaum vom Biber zerfressen
Gestern bin ich dann mal wieder bei diesem Apfelbaum vorbei gekommen, und der stand in vollster Blättertracht, mit auch jeder Menge kleiner Früchte dran, sogar der vordere/untere Ast, welcher gänzlich von der Rinde befreit wurde. So weiß ich nicht, was geschehen wäre, wenn die Biberfamilie nicht verscheucht worden wäre durch die Gewässerschutzarbeiten für den kleinen Bach hier. Doch von diesem Zustand hier auf dem Bild konnte sich der Apfelbaum wieder erholen, erstaunlich.
gott ist.
Punkt.
Ein "Inception-Effekt":
Gestern hatte ich dann nach langer Zeit mal wieder bei matt vorbei geschaut, was der so macht. Weil er für meine Begriffe ja irgendwie "fest zu stecken" scheint, war er dann irgendwann nicht mehr interessant für mich, doch dennoch bleibt er ja ein kluger Kopf, man erinnere sich an die Schöpfung des Begriffes "reality Breakdown"!, welcher besagt, dass - wenn die Welt "physisch" wäre - diese oder jene Ereignisse nicht hätte so oder so statt finden können. Da sie aber ganz empirisch so Statt gefunden haben, bedeutet das dann, dass "die Welt" nicht "physisch" sein kann. Stellt euch etwas übertrieben vor, die wirklichkeit hier präsentiert sich wie bei Inception (in Teilbereichen, oder ab und an), dann wäre klar, dass das hier keine physische Veranstaltung ist, sondern man in einer Art Traum sich gerade befindet. So, und wie ich dann ein paar Monate zurück seine Podcasts überflog, stieß ich dann auf ein für einige vielleicht interessantes Video.
Für mich jedenfalls waren die Kommentare interessant, die Präsentation von matt werde ich mir vielleicht anschauen, doch eben, da es mein derzeitiges Lieblingsthema betrifft, also "physisch (erklärbar) ist: garnichts", dachte ich mir, dass man es herein nehmen könnte.
Der Aufhänger wohl, warum ich es hinein genommen habe, war dieser Kommentar.
So erinnere ich mich noch sehr genau an meine Schulzeit, es muß wohl so 2te Klasse gewesen sein, dass ich Mitleid mit den Australiern hatte, weil die ja mal eben so nirgends hingelangen können, "daunten" (rechts) auf der Karte, tausende Kilometer von allem, von allen anderen entfernt. Mal eben kurz mit dem Kutter von Helgoland auf's Festland, das ging da nicht. Damals nicht, heute - siehe Kommentar - kann man fast zu Fuß durchs Meer herüber waten, oder doch schwimmen.

Und das ist schon nicht mehr ein "Mandela", sondern eher schon ein Inception-Effekt. Da sieht man mal, in welcher Größenordnung wirklichkeit sich verändern kann, ohne dass es den Playern hier im digitalen online Game auffällt. Vielleicht sind solche Veränderungen aber auch ein Test, wie tief die menschen an diesen Traum hier als "echt" glauben. Ein ganzer Kontinent verschiebt sich um über tausend Kilometer in nur 50 Jahren, und es gibt kaum einen, den das stutzig macht.
ich mein', da muß man dann schon wirklich dolle tief schlafen.
Für uns, die wir vielleicht auch nur annähernd wissen, dass wir uns hier befinden ...

... ist ja klar: "ok, hier kann einfach alles geschehen", doch ich wollte mit diesem kurzen Einschub nur mal kurz verdeutlichen, in welchem Umfange hier selbst "kontinentale Veränderungen" möglich sind - und nahezu niemandem fällt das auf. Was aber ! auch dafür ein Hinweis sein könnte, dass die Dateien, die man so "Erinnerungen" nennt bei den Meisten wohl mitgeändert werden, also wer als 8-Jähriger da oben rechts an der Spitze von AU die ganze Zeit gelebt hat, sagen wir mal in 1975, anstatt im Niemandsland ("down uinder") damals, über tausend Kilometer entfernt vom Festland nun nach nur 50 Jahren herüber schauen kann, dem muß einfach die Erinnerung überschrieben worden sein. Man überlege, und das muß bei Millionen menschen geschehen sein. Wenn nicht gar Milliarden.

Ja, "Dark City", an der Bühne hatte sogar max igan mitgewirkt,
was vielleicht bedeutet, das der Film in Australien auch gedreht wurde ?
Jedenfalls nennt es nicht Australia, sondern Apathralia, also von einem Land, wo
fast alle sich in einem apathischen Zustand befinden. Passt doch recht gut
zusammen, gott hat humor.
Nur nochmal wiederholt: was sagt uns dass, wenn selbst ein ganzer Kontinent mal
eben so erst hier, dann dort sich befindet, und keinem, fällt's auf ? Es kann
nur bedeuten: die Erinnerungen werden gleich mit geändert.
"Wir müssen davon ausgehen, dass auch "Vergangenheit" so
etwas, wie eine Datei ist"
john archibald wheeler
Und wer oder was bestimmt, ob deine Erinnerung gleich mitgeändert wird, oder nicht ? Mich deucht, es hängst sehr damit zusammen, wie sehr man sich für das Ganze, für wirklichkeit als solche interessiert.
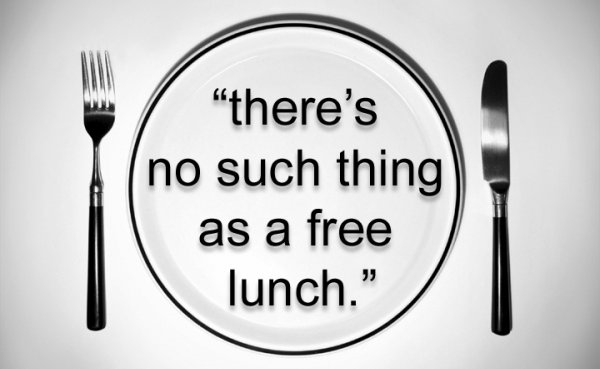
Interessiert dich das Ganze nicht, sondern nur du dich für dich und deine Familie, dann lässt dich wirklichkeit auch nicht teilhaben am Umbau der Bühne, dann kannst du nicht erkennen, zu was sie fähig ist, und bleibst in der "physischen Auffassung" weiterhin eingemauert. Hast du immer schon über deine Belange, oder auch die Belange der Familie heraus geschaut, lässt dich wirklichkeit auch teilhaben, denn ?
Klopfet an, so wird euch aufgetan
matth 7 7
Und nun ?
tom on Fire ! :-)

Quantum Mechanics Expert: How to be Break Free From The Past,
Be Happy & Find Your Greater Purpose
und
maharaj ji zeigt uns, dass es gott gibt
Wie gesagt, dieses Buch ist noch erschwinglich zu haben ! Hier, für 22 Euro: LINK


|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
22.05.2025 n. Chr. 07.19 Uhr
|
"Bei einer Messe in Stuttgart kam ich mit einem bekannten Chemiker ins Gespräch. Ich versuchte ihm zu erklären, daß wir mit dem ausgestellten System Schwermetalle bis zu einem nicht mehr meßbaren Grade reduzieren können. Es handelt sich hierbei nicht um ein Filtersystem, sondern um einen durch Informationsübertragung hervorgerufenen Effekt, der die Selbstheilungskräfte des Wassers aktiviert. Wir haben derartige informationstechnische Trinkwasserreinigungssysteme in einem durch eine Ölraffinerie verpesteten Gebiet in Ecuador installiert. Die Schwermetallbelastung des Regen- und Grundwassers durch Blei und Quecksilber war derart hoch, daß die Menschen in den umliegenden Dörfern reihenweise erkrankten. Die Wirkung des von uns installierten Systems wurde damals durch wissenschaftliche Meßreihen begleitet und bestätigt, das Resultat läßt sich aber auch in wenige Worte packen: klares Trinkwasser mit signifikanter Reduktion von Schwermetallen! Ich erinnere mich noch genau daran, wie ihn diese Erklärung zur Weißglut brachte. Was ich da sage, so der Sachverständige, könne es alles nicht geben! Ich bot ihm kurzerhand an, daß er das System mit meinen Produkten gerne bei sich im Labor testen könne. Gleichzeitig fragte ich ihn aber auch, was er denn machen würde, wenn er am Ende tatsächlich auf dasselbe Ergebnis käme; er würde es, so sagte er, dennoch nicht glauben, denn was ich von mir geben würde, könne einfach nicht sein, da sonst die ganzen wissenschaftlichen Denkmodelle falsch wären ! Bei ihm stapelten sich die Bücher, und viele nahm er zur Hand, um mir meinen Irrtum deutlich zu machen. „Roland“, sagte er, „hier steht überall, daß das nicht sein kann, was du da machst !“
roland plocher, wenn einer weiß, was irgendwie sonst keiner weiß ...
|
Gut zu sehen, wie auf einer Autobahn kommt die kühlere Luft direkt aus dem Norden. Nahezu ganz Europa ist für die Jahreszeit ein wenig zu kühl.
Der Träume wieder reichlich, und der letzte ging wieder mal, wie jetzt seit gefühlt zig-Jahren, wie man wieder nach Hause gelangt. Es ist immer dasselbe Kernthema, man ist irgendwo, will oder muss aber seine Zelte aufbrechen, die gemietete Ferienwohnung wieder sauber hinterlassen, weil Aufbruch angesagt ist, es geht nach Hause. Heute im Traum war es so, dass ich noch knapp eine Woche hätte unter widrigen Umständen irgendwo aushalten können, bis mir nach 2 Tagen einfiel, dass ich ja etwas Geld in den Taschen hab', und einfach die Bahn zurück nehmen kann, und nicht noch weitere 5 Tage dort abhängen muss. So wusste ich zwar nicht recht, wo ich nun eigentlich war, noch, wo eine Bahnstation sich befindet, doch brach einfach auf, nach dem Motto: das wird sich schon finden.
Und: dünner und dünner wird die Luft. Es passt gut, dass tom
beinahe "Mainstream" geht, jetzt mit Interviewpartnern, welche ihm sogar Aufrufe
über zwei Millionen beschert haben, denn nach 6 oder gar mehr Jahren intensiver
Beschäftigung mit tom, scheint das Gröbste einverleibt, und nun ist es an der
Zeit, dass er seine Inhalte einem größeren Publikum näher bringt. Das ist dann
nicht mehr so speziell, also in's Detail gehend, wie etwa der für mich legendäre
"Marseille-Workshop",
sondern diese neueren, "größeren" Interviews wirken mehr wie ein Kompendium, es
wird zusammengefasst, und angerissen.
So war es bei mir in gewissem Sinne "anders herum", ich kam vom
Doppelspaltexperiment, und die Implikationen waren mir recht schnell klar -
diese wirklichkeit hier kann keine "physische" sein (auch wenn sie so wirkt).
Doch in der Suche fand sich dieses in der Trivial"wissenschaft" nicht wieder,
der nach wie vor herrschende Tenor in dieser scheinbaren "Wissenschaft" war nach
wie vor noch der newtonsche, ein Atomchen stößt das andere and, und so bewegen
und verändern sich hier die Dinge.
Doch stimmte halt die alte "Wissenschaft" nicht mehr mit den Ergebnissen, und noch weniger mit den Implikationen des DSE überein, doch nahezu alle "Erklärungen" des DSE, welche sich mir in der Recherche präsentierten, waren keine, da sie ja sämtlich genau aus dem Paradigma heraus ("Wellen", "Teilchen") stammten, welches das DSE ad absurdum führte. Und ich glaube der erste auf den ich stieß, welcher das DSE eben aus einem neuen, nicht "materiellem" Paradigma heraus erklärte, war dann tom campbell. Neben der alten Riege von damals, also niels bohr, planck, einstein, heisenberg und den etwas "Neueren", also edward fredkin, john archibald wheeler, hans peter dürr, blieb tom campbell aber nicht stehen bei der einfachen Erklärung des statistischen Verhaltens von (letztlich virtuellen) "Teilchen", sondern spann auf logischem Wege heraus, was das eben noch alles so mit sich bringt. Eine der wohl weitreichendsten Implikationen dürfte sein, dass dann wirklichkeit faktisch nicht "hier" geschieht, sondern "in other" (edward fredkin), was in einfachen Worten bedeutet, dass "hier" letztlich garnichts geschieht. Weil hier nichts "geschehen" kann (auch wenn es fünfhunderttausendmal so wirkt, als ob).
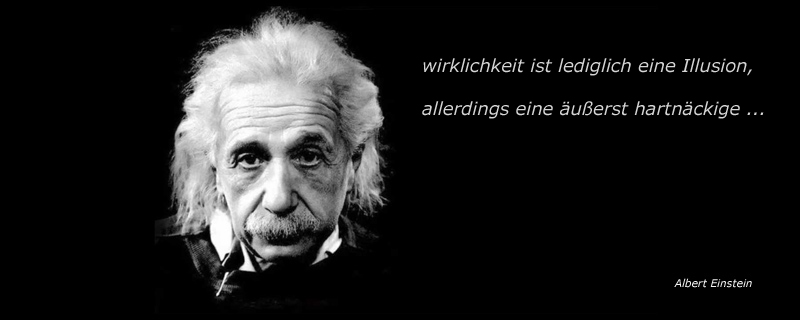
Und solch ein Grundlagenvortrag, über 3 Tage ! ist eben der Marseille-Workshop, welcher "von der Pike" auf die Ergebnisse des DSE erklärt, und was das vor alles mit sich bringt. Eine Tafel aus dem Marseille Workshop:
Es dauert dann aber noch eine ganze Weile, bis man es in der Tiefe begriffen hat, dass das, was man noch immer ! als "Wissenschaft" bezeichnet, nichts weiter ist, als tiefer Mystizismus, und noch weniger Anhaltspunkte für Wahrheit bieten, als Religionen. Aber es bedarf aber auch schon Hartnäckigkeit, und beständiges sich konfrontieren mit harter Logik, um zu dieser Einsicht zu gelangen, siehe einstein oben.
Doch zurück zum Anfang, die Luft wird dünner und dünner, neben tom, welchen ich noch immer mir anhöre, ist jetzt (aktueller "Stand") nur noch krishna das geblieben. Mal die Musik, mal seine Erzählungen, alles scheint mir durchzogen von maharaj ji, und es ist so, als würde ich matthäus lauschen, der halt 2000 Jahre später als Barde auftritt. Im Grunde ist es, wie lahiri mahasaya schon sagt, so, dass es im Grunde im Sinne von "existieren", von "geben", nur eines gibt: gott, oder eben die "lcs", von tom so genannt. In Indien ( in di a ) hat man da noch ein paar mehr draus gemacht, je nach Funktion, finde ich auch richtig. So hat ja auch jede große Firma, welche online-Games entwickelt und betreut, verschiedene Abteilungen, und demnach Abteilungsleiter. Das wären dann sozusagen die götter unterhalb gottes :-)
:


|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
24.05.2025 n. Chr. 07.16 Uhr
Gestern Nacht 2°C, heute Nacht waren's 4°C, man sieht aber gut, woher die kalte Luft kam, direkt importiert aus dem hohen Norden, wie auf einer Autobahn.
Im kalten Osten nachts 19°C in Moskau, aber nur 10°C in Madrid, und das Ende Mai ...
Gestern und vorgestern war luca hier, mit seinem Kumpel valentin. Die beiden hatten sich in einem der Yoga-Vidya "Zentren" kennen gelernt, und es gab natürlich viel zu quatschen, zentrales Thema war immer wieder, wie in einer virtuellen wirklichkeit es sich letztlich mit dem so genannten "freien Willen" verhält. Das Durcheinander und die Missverständnisse in der Diskussion rühren dann aber zuallermeist daher, dass man aus Gewohnheit immer wieder in die alten Denkmuster rutscht, und von der Warte heraus denkt, und argumentiert, dass hier etwas "ist", respektive geschieht. Oder einfacher, dass das, was hier zu geschehen scheint, auch de facto hier seinen Urstand hat. Man täte gut daran, in den Diskussionen sich immer wieder "zu norden", das heißt, zu erinnern, dass "hier" ja nicht der wahre Ort des Geschehens sein kann, und dann gemäß in der Diskussion sich an diesen Aufbau von wirklichkeit immer (wieder) zu erinnern.
remember god
maharaj ji
Ohne freien Willen lässt sich garnichts denken, kein spiel, kein Vorankommen, kein Wachstum, nichtmal Existent von Bewusstheit. Es gäbe kein Wagnis, kein Verlust, kein Gewinn, kein Mut, keine Courage - einfach nichts dergleichen. "Entscheidung" gäbe es nicht, oder sie wäre Illusion. Damit eben auch keime Entwicklung, und so weiter. Doch "wo" eben der freie Wille zu suchen ist, darüber ließ sich halt trefflich disputieren. Woran man sich dann aber - eigentlich - immer wieder neu erinnern müsste, weil man es nur allzu leicht vergisst: "hier" kann er nicht sein. Wie eben keine Figur im online Game sich selbst animiert, genauso wenig wie das dort im Winde wedelnde Blatt eines Baumes.
Also "hier" den freien Willen zu verorten, ist einfach nicht logisch, Unsinn also. Und das kommt uns auch anderweitig "zu Pass" nämlich wir hier unser wahres Wesen weder "hier" verorten, noch ihm diese (schein-) materiell Natur zuschreiben. So sind wir halt nicht im Spiel, sondern "nur" am spielen.
"Die moderne Physik verwandelte das Bild vom
Universum als einer Maschine in die Vision eines unteilbaren dynamischen Ganzen,
dessen Teile grundsätzlich in Wechselbeziehungen zueinander stehen und nur als
Muster eines kosmischen Prozesses verstanden werden können [...].
Es herrscht Bewegung, doch gibt es letztlich keine sich bewegenden Objekte; es
gibt Aktivität, jedoch keine Handelnden; es gibt keine Tänzer, sondern nur den
Tanz."
fritjof capra, Wendezeit
Alles "Geschehen" eines multi Player Games dann auf dem Screen ist - trivial ausgedrückt - bereits Vergangenheit. Es ist bereits geschehen, heißt sogar so. Jetzt auch die Zitate solche Größen wie ramana maharshi, maharaj ji und vieler anderer solchen Kalibers passen, dass es "hier" nichts zu rütteln gibt. "Hier", das ist auf deutsch: immer nur die Mitteilung des letzten Zwischenstandes der Rechnung.
Da es in dem Sinne von "geben" keine "Energie", keine "Wellen", "Teilchen", "Schwingung" oder sonstwas gibt - wie sollte denn die Sonne hier für auch nur irgendwas verantwortlich zeichnen ? Genau, man wird sich bewusst, dass im Videogame ja die Sonne nicht die Ursache dafür ist, dass es hell wird - auch wenn es tausend Mal so scheint (insofern man sich ja "selbst" grad in diesem Game befindet ).

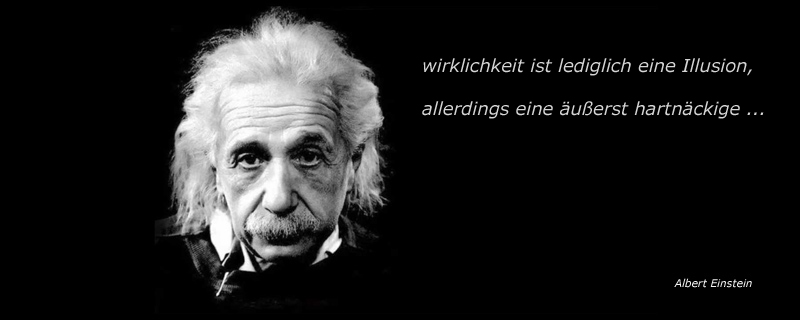
Und ich glaube so kam es immer wieder zu den Ungenauigkeiten, Unschärfe und Durcheinander in der Diskussion, weil sich halt immer wieder der Denkfehler hartnäckig einschleicht, dass "hier" der Ort des Geschehens ist, während de facto "hier" nur die Mitteilung des Geschehenen ist. Geschehen, Vergangenheit, wie eben das "Geschehen" auf dem Screen. Und klar, weil wir keine rechte Idee haben, wie wir uns denn nun uns den wahren "ort" dieses Geschehens vorstellen können, oder dürfen, und wie es "dort" wohl so eingerichtet ist, sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt, so dass jeder dieser freiren Lauf lassen kann. Doch adäquate Näherungen, Beschreibungen wohl kaum zu finden sein dürften, versucht mal zu beschreiben, wie euer Videogame im Rechner sich darstellt, also dort, wo es faktisch Statt findet.
Dafür haben wir keine Sprache und so denke ich, dass man sich bloß mit Metaphern wird behelfen müssen. "Dort" also, wo wirklichkeit faktisch sich abspielt (nicht die Mitteilung dieses Geschehens, was wir "hier" nennen), lässt sich mit Worten und Begriffen einfach nicht hin gelangen, daher wohl auch die von der größten Aufmerksamkeit begleitete Diskussion irgendwann in einem Durcheinander enden muß, schlicht, weil, je näher wir der Sache kommen, um so mehr uns die Begriffe ausgehen ...
Viele beklagen sich, daß die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse seien, aber unverwendbar im täglichen Leben, und nur dieses allein haben wir. Wenn der Weise sagt: „Gehe hinüber“, so meint er nicht, daß man auf die andere Seite hinübergehen solle, was man immerhin noch leisten könnte, wenn das Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes Drüben, etwas, das wir nicht kennen, das auch von ihm nicht näher zu bezeichnen ist und das uns also hier gar nichts helfen kann. Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich nur sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist, und das haben wir gewußt. Aber das, womit wir uns jeden Tag abmühen, sind andere Dinge.
Darauf sagte einer: „Warum wehrt ihr euch? Würdet ihr den Gleichnissen folgen, dann wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe frei.“
Ein anderer sagte: „Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist.“
Der erste sagte: „Du hast gewonnen.“
Der zweite sagte: „Aber leider nur im Gleichnis.“
Der erste sagte: „Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast du verloren.“
franz kafka
Von den Gleichnissen


|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
30.05.2025 n. Chr. 07.42 Uhr
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
Prof. tuscott, Australian National University, 27 Mai 2015 Link
Mit aktuell 22,2°C wird es so langsam etwas zu warm hier oben unter'm Dach, also beginnt so langsam aber sicher wieder das "Wärmemanagement" mit verschiedenen Maßnahmen, Schotten auf, Schotten dicht, je nachdem ob es draußen kühler oder wärmer ist, Rollläden runter, etc.. In der Bude ist ja eh nicht wirklich die "frische Luft", wie sie draußen anzutreffen ist, und wenn's dann auch noch zu warm wird, macht das nur träge.
Gleich nach dem Aufwachen hatte ich so ein Gefühl, "heute ist wieder derselbe Tag", also dieses "täglich grüßt das Murmeltier"-Moment. Das empfinde ich als nichts Schlechtes, es eben wieder (erstmal) derselbe Tag, an welchem du nun aber die Chance hast, etwas völlig anders zu machen, als du jemals gemacht hast, und dadurch aus einem der vielen Loops, in welchen man drin hängt, heraus zu brechen, und sich aufzuschwingen. Zu Deutsch: dazu zu lernen.
Es geht täglich nur ein kleines stück
maharaj ji
Wie? In diesem kurzen, eiligen, von einem ungeduldigen Dröhnen
begleiteten Leben eine Treppe hinunterlaufen? Das ist unmöglich. Die dir
zugemessene Zeit ist so kurz, daß du, wenn du eine Sekunde verlierst, schon dein
ganzes Leben verloren hast, denn es ist nicht länger, es ist immer nur so lang,
wie die Zeit, die du verlierst. Hast du also einen Weg begonnen, setze ihn fort,
unter allen Umständen, du kannst nur gewinnen, du läufst keine Gefahr,
vielleicht wirst du am Ende abstürzen, hättest du aber schon nach den ersten
Schritten dich zurückgewendet und wärest die Treppe hinuntergelaufen, wärst du
gleich am Anfang abgestürzt und nicht vielleicht, sondern ganz gewiß. Findest du
also nichts hier auf den Gängen, öffne die Türen, findest du nichts hinter
diesen Türen, gibt es neue Stockwerke, findest du oben nichts, es ist keine Not,
schwinge dich neue Treppen hinauf. Solange du nicht zu steigen aufhörst, hören
die Stufen nicht auf, unter deinen steigenden Füßen wachsen sie aufwärts.
franz kafka
das gesamte leben ist eben genau dieser Prozess, und zu lernen scheint es hier unendlich viel zu geben, allerdings auch: zu verlernen, abzulegen, fallen zu lassen. Letzteres wohl zuerst angegangen werden sollte, da man ja sein Gebäude auf einem sauberem Fundament aufbaut, und nich auf wackligen, zusammenhanglosen und bloß improvisierten Bauten. Manche haben dann irgendwann das Glück, dass sich - ähnlich wie bei "täglich grüßt das Murmeltier" dann mit einem Tag sich alles verändert, man viele Loops mit einem Male durchbricht, aus ihnen heraus kommt, doch für die Meisten ist das ein langwieriger, zäher Prozess, welcher beinahe unvermerkt verläuft.
Nicht wenige es aber auch noch gibt, die ihr ganzes leben nicht nennenswert vorangekommen sind, zumeist deswegen, weil sie dem "Zeugs", dem Äußerem, dem Materialismus, der Bühne zugewendet, oder gar verschrieben haben. Sie scheinen dem Motto gemäß zu leben, dass nur echt und von wert ist, was man in Händen halten, sehen, berühren, zeigen kann, und haben vergessen oder verdrängt, dass ja alles im "Inneren" nur statt findet, welches die Bedingung also für die ganze ! "Show da draußen" ist.
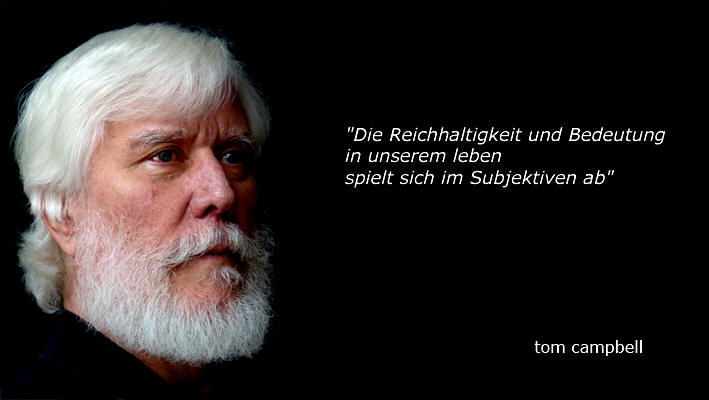
Selbst in der Logik, der Philosophie hat man recht früh bereits erkannt, dass außerhalb von Bewusstheit ja nichts als solches "sein", existieren kann. Ein jeder hat verschiedenste Inhalte seiner Bewusstheit, und diese stellen sich dann dar als die Umgebung, der Streit mit dem Partner, Gefühle, Gedanken, die Schmerzen im Rücken, die gesamte Körperlichkeit, Trauer, Depression und so weiter. Im Grundsatz ist oder besteht das Alles erstmal aus demselben Zeugs.
"Etwas der Bewusstheit Gegebenes", Datum.
"Daten" ließe sich damit übersetzen in "Gegebenheiten". Diese Daten (Gegebenheiten) also nehmen wir wahr, in unserer "individuierten Einheit von Bewusstheit" (tom, iuoc), und stellen sich zuallererst einmal dar als ein Körper + dann das diesen Umgebende (Raum), und dann scheint in diesem Körper (Einschachtelung) nochmals wieder etwas nicht-räumliches, sondern zeitliches vor sich zu gehen, wie Gedanken, Gefühle, etc. Das grundsätzlich Alles ! aus ein- und demselben "Zeugs" (Brahma) besteht, bekommen wir aufgrund dieser Einschachtelung nicht mit. Für uns geschieht Bewusstheit aufgrund des Körpers, wobei es faktisch genau umgekehrt ist, der Körper und das Räumliche überhaupt (wie auch das Zeitliche, Gedanken, Gefühle etc.) basiert auf den gegenwärtigen Inhalten (Gegebenheiten, Daten) von Bewusstheit.
Natürlich, es wirkt erstmal überhaupt nichts so, doch man schaue mal, wie leicht sich ein lebewesen bereits durch nur geringe Maßnahmen täuschen lassen kann !
Und jetzt überlegt, was das bedeutet, wenn man kann seine
"VR-Brille"
hier nicht einmal sehen, geschweige denn abnehmen kann!
Fühlen kann man sie immerhin manchmal ...
lahiri mahasaya

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
01.06.2025 n. Chr. 07.51 Uhr
Ein paar Schwertlilien sind dieses Jahr gekommen, es war also regenreicher als die letzten paar Jahre. Die gesamte Reihe bis hinten zum Gebäude, das sind alles Schwertlilien, aber "geschafft", also zur Blüte, haben es nur diese ...
daria ist nur 2 Stunden angeleint, welche sie dann meistens zum
Schlafen nutzt.
22 Stunden am Tag kann sie sich auf hektarweise Gelände frei bewegen.
Tja, der Mai ist "um", also ? Genau, jetzt ist es nicht mehr weit hin bis Weihnachten. Ein paar Mal mit den Augen gezwinkert, und schon ist der September da, der Herbst, wobei dann aber natürlich auch schon wieder das Frühjahr vor der Tür steht. So versuche ich ja (auch) den Tag möglichst einzufangen (carpe diem), indem ich versuche, mich nicht in Geschäftigkeit zu verlieren, und dennoch rast der Tag an mir vorbei, zerrinnt mir zwischen den Fingern, wie wohl für viele andere auch. Überhaupt ist mir gestern Abend eingefallen, mit welcher enormen Selbstverständlichkeit man hier das Leben beginnt. Erinnert euch mal an die Kindheit, mit welcher Selbstverständlichkeit und auch gewisser Sicherheit man mit der ganzen Sache "hier" umgeht - als ob man das Spiel schon tausende Male gespielt hätte. Denn eigentlich müsste man völlig anders reagieren, wenn man tatsächlich das "erste Mal" überhaupt Existenz erfährt. Sobald man irgendwie überhaupt einen komplexeren Gedanken zu bilden in der Lage ist, müsste man doch total perplex sein, und sich fragen, was man selbst überhaupt ist, und dann noch das Ganze, also Alles. Was ist das Alles ? Inklusive der eigenen Wenigkeit. Es ist schwer, da eine Metapher zu bilden, aber stellt euch vor, aus der Schwärze einer Ewigen Nacht und Unbewusstheit habt ihr mit einem Male eine Spielfigur erhalten, und müsst euch nun durch irgendwas hindurch arbeiten, was so extrem vielfältig und breit gefächert an Möglichkeiten und Erfahrungen ist, wie solch ein menschenleben.
Unendlich viel mehr Fragezeichen mehr müsste man über diese plötzlich aufgekommene Existenz haben, als ein jeder faktisch hat. Ganz im Gegenteil, im Wesentlichen geht hier jeder so durch, und eben schon ab der Kindheit an, als hätte er das schon tausende Male gemacht. Klar, dieses Videogame hier hat auch dafür, also für diesen "reality Breakdown" seine Plausibilitäten parat, also "Neuroplastizität", "Genetik" und was weiß ich noch für scheinphysische "Erklärungen", doch sind diese ja keine. Oder ich sage mal, es sind nur so lange "Erklärungen", solange man noch denkt, man befände sich in einer "physischen" wirklichkeit, welche aufgebaut sei aus Molekülen, Atomen, Feldern, Schwingungen, Energie und all dem Bullshit, welcher keiner vernünftigen Betrachtung Stand hält, nachdem man die Implikationen des Doppelspaltexperimentes verstanden hat (respektive entsprechende Freischaltungen erhalten hat).
Die Sicherheit, mit welcher halt bereits die kleinsten Kinder ihre Spielfigur ausfüllen, wenn auch anfangs eingeschränkt, zeigt einfach auf - das allererste Mal kann es einfach nicht sein. Überlegt, wie ihr ein Computerspiel angeht, nachdem ihr es schon hunderte Male gespielt habt. Da beginnt man einfach mit einem "ok, es geht wieder los", die nervigen ersten Level, durch welche man einfach durch muß, bis es dann so langsam wieder spannend zu werden beginnt. Und nehmt noch dazu das Ende des Durchgangs, den "Tod". Viel mehr, als die menschen in faktisch fürchten, müsste er gefürchtet werden, da er ja - physisch betrachtet - das Ende von schlichtweg Allem bedeuten würde. Und viel viel viel viel viel mehr, als es de facto der Fall ist, müsste dieser unser tägliches Handeln und Denken beeinflussen. Doch an dem ist es nicht - die menschen handeln im Groß so, als würden sie ewig leben, respektive diese ganze Geschichte mit "Tod" ihnen doch recht wenig zu schaffen macht. Manche beim Gedanken "Tod" garnicht ihr Ableben im Kopf haben, sondern nur, wen sie was vermachen sollen und andere Gedankengänge, welche letztlich garnicht sie selbst betreffen.
Natürlich, und das ist ja auch nur zu verständlich, wird fleißig Angst geschürt im Spiel, vor "Tod". Doch wenn man mal genau hinschaut, dann wird diese Angst von institutioneller Seite geschürt - diese kommt nicht von den menschen selbst. Dieses Schüren der Angst vor Tod, oder sogar geringerer scheinbarer Kalamitäten, wie Verlust, wie "ungenügend sein" und anderer scheinbarer Minderwertigkeiten, auch materieller Natur, hilft ja enorm dabei, diese "Existenz" hier fürchterlich ernst zu nehmen.
Und genau damit ist dann ja das Wesentlichste erstmal
erreicht.
Das Spiel wird nicht mehr als Spiel, sondern als blutiger Ernst wahr genommen.
Diese Einrichtung ist zwar im Spiel gefühlt "nervig", doch zoomt man dann ein wenig weiter aus, wird klar, dass sie dann doch notwendig ist, damit ein jeder echt denkt, dass es hier wirklich echt ist.
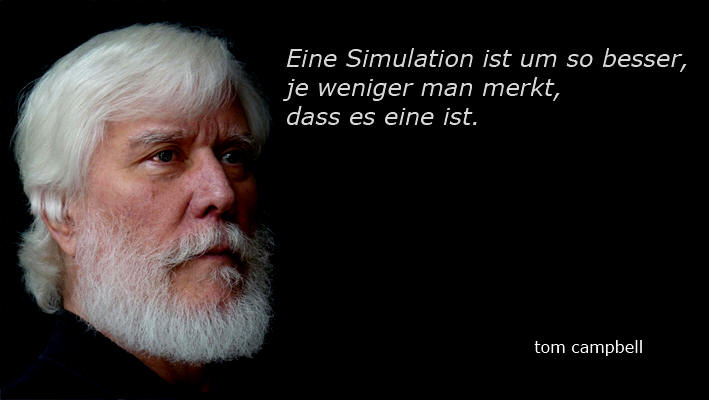
Allerdings !, und das finde ich sehr gut und fair (gerecht), wenn man sich wirklich hartnäckig müht um die natur von wirklichkeit, dann wird einem dann doch der Schleier gehoben, und mit Glück sogar auch noch die letztlich digitale, animierte natur von wirklichkeit mehr oder minder offenbart. Das ist der Weg über die Hartnäckigkeit, und wohl auch die erste Wahl, denn niemand ja weiß, ob ihm eine NTE zu Teil wird, oder er eine Freigabe zur OBE erhält. Man könnte denken, dass OBEs und NTEs wie Joker im Spiel verteilt sind, doch gehe ich auch bei diesen davon aus, dass sie aus ganz spezifischen Gründen den jeweiligen "zugeschanzt" respektive ermöglicht werden.
Also, sagen wir mal so - nicht alle müssen dieses typische leben haben.
Es gibt genügend ! Hinweise hier im multi Player online Game - dass es eines ist. Nur ?
Genau ...

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
02.06.2025 n. Chr. 07.30 Uhr
Etwas meinungslos gerade. Wenn man sich aus dem Mainstream, dem Truther-Genre, wie auch den pseudo-philosophischen/spirituellen Seichtigkeiten heraus hält, bleibt so viel Neues für jeden Tag ja auch nicht zu schreiben. Wie sah das Tagebuch von neem karoli baba aus ? Genau, es enthielt nur ein einziges Wort, immer wiederholt:
Und dieses Wort war "ram", also gott. Doch bei etwas genauerer Betrachtung nicht ungewöhnlich, denn der gottloseste Mensch dieses Wort dieses Wort vielleicht nicht ein einziges Mal in seinem leben in den Mund genommen hat, doch je mehr man sich nicht nur um sich (und vielleicht noch Familie), sondern auch um das Ganze kümmert, desto weniger kommt man an "ram" vorbei. Und maharaj ji hatte sich ja überhaupt nicht um sich, sondern letztlich nur um die anderen gekümmert.
Natürlich hat die bunte Bühne "da draußen" schon ihren Einfluss auf uns. Sie erstreckt sich da tägliche leben, wenn wir einkaufen, auf menschen treffen und mit ihnen reden, oder auch manchmal garnicht reden, denn es oft auch in den Gesichtern bereits zu lesen ist, dass die menschen etwas bedrückt, obwohl sie doch körperlich gesund zu sein scheinen. Das vergisst man nur allzu leicht, dass man sich wirklich glücklich schätzen kann, sobald man bloß gesund ist.
Doch zuviel drängt beinahe täglich auf beinahe jeden ein - von außen, von Seiten der Bühne, auch unvermeidlich. Und im wesentlichen läuft die Zudringlichkeit von wirklichkeit über "Geld". In der Rangfolge der Würdigkeit, was einen kümmern sollte, müsste dieses Thema weit hintan stehen, doch hängt an "Geld" eben auch Bequemlichkeit und das scheinbar Angenehme, und mit diesem beinahe angeborenen Irrtum sind wir alle versehen (oder fast alle). Auch ich muß mir - wenn es um dieses Thema geht - dann immer wieder die Begebenheiten mit etwa bhagawan nityananda oder eben auch neem karoli baba lebhaft vor Augen führen, dass man das leidige "Geld" auch aus dem Maul eines Krokodils, oder aus einem Kaninfeuer heraus ziehen kann. Sofern man halt die Freigabe für solch einen "god-Modus" im Spiel besitzt, was auf mich aber nicht zutrifft.
Alles Geld der Welt ist meines, auch das in Amerika ...
neem karoli babo
Als patrick mal "geldmäßig" über den Tisch gezogen wurde, hatte er auch genau das gemacht, um sich der Würdigkeit eines Ärgernisses bewusst zu werden, nämlich er hat sich wieder in Erinnerung gerufen dass man "Geld" zur Not auch aus dem Feuer ziehen kann. Wenn ich daran denke, photographiere ich die Begebenheit mit dem sadhu, welchen maharaj ji ordentlich "aufzieht", und bringe die morgen. Doch in der kurzen Recherche habe ich von der ehemaligen Ehefrau von raghu markus etwas gefunden, also von parvati markus, unter "neem karoli baba money Story" (aus ihrem Buch).
ich war ein wenig paranoid, dass American Express gegen maharaj ji vorgehen würde ...
Hier, was bei yvette rosser passierte, "Geld" ...
Maharajji sagte einmal: "Alles Geld der Welt gehört mir." Aber
die meisten von uns hatten nicht viel Geld, als wir in Indien waren. Maharajji
war immer um das finanzielle Wohlergehen seiner ausländischen Anhänger besorgt,
die in Indien kein Geld verdienen konnten. Er forderte jemanden mit einem
Geldüberschuss auf, einen bestimmten Betrag an jemanden zu geben, der nichts
hatte. Irgendwann wurde "der Fonds" mit Geldspenden von wohlhabenderen Westlern
ins Leben gerufen, um diejenigen zu unterstützen, die völlig pleite waren.
Maharajji hatte Spaß an diesem Umverteilungsspiel, das einige Menschen dazu
veranlasste, ihre Bindung an Geld zu überdenken. RamRani's Geschichte
veranschaulicht einen weiteren Aspekt von Maharajjis Spaß und Spielen in Bezug
auf Geld.
RamRani (Yvette Rosser) reiste nach ihrem Highschool-Abschluss nach Europa, um
die Familie ihrer Mutter in Belgien zu besuchen. Sie trampte durch Europa und
gelangte nach Afghanistan. Nachdem sie einige Monate in Kabul verbracht hatte,
kam sie im Dezember 1970 in Indien an, wo ihr alles so vertraut vorkam.
RAMRANI:
"Im Februar 1972 war ich in Kathmandu und wohnte in Swambunath.
Ich hatte einen Traum von einem kleinen, dreieckigen Mann in karierter Kleidung,
der in der Ferne saß und seine Handfläche im indischen Stil auf und ab bewegte,
um mir zu signalisieren: "Komm her." Ich wachte auf und fragte mich, wer dieser
dreieckige Mann war. Ich hatte selten so lebhafte Träume.
Ich ging zum Tewari-Teeladen, und jemand hatte dort ein Exemplar von "Be Here
Now". Ich schlug die Stelle auf, an der Maharaji auf dem Feld sitzt, ein
kariertes Dreieck mit seinem Arm, der aus seiner Decke herausragt. Krishna
Dobrer erzählte mir alles darüber, wie er bei Satya Tulku Rinpoche Zuflucht
gefunden hatte, bei den Tibetern lebte und es liebte.
Schließlich reiste ich 1972 zu Durga Puja nach Indien und machte einen
Goenka-Kurs in Varanasi [Benares], wo ich Saraswati und andere Anhänger von Neem
Karoli Baba traf. Nach einem kurzen Abstecher nach Goa, um nach einem
afghanischen Welpen zu sehen, den ich zwei Jahre zuvor bei einer Familie
zurückgelassen hatte, fuhr ich schließlich nach Vrindavan, um diesen Baba zu
treffen, von dem ich geträumt hatte. Maharajji saß auf seinem Takhat. Sobald ich
ankam, bedeutete er mir, mich näher zu setzen, dann noch näher. Er fragte mich
mehrmals, woher ich komme und wie ich heiße. Er war sehr lieb zu mir und sehr
aufmerksam. Das war mir etwas peinlich, weil mich alle anstarrten. Ich erkannte
einige Leute aus den Goenka-Kursen wieder. Dann schickte er alle weg und sagte
ihnen, sie sollten mich zum Dharmasala bringen.
Ein dickes, hellblaues Holztor trennte den Tempelbereich vom hinteren
Dharmasala-Bereich. Es war von innen verschlossen. In dem Holztor befand sich
ein kleines Guckloch. Ich starrte durch das Guckloch, und Maharajji schaute
immer wieder zur Tür und winkte mich herbei, genau wie in meinem Traum. Baba
lachte und lachte. Er zeigte mir, dass er mich in meinem Traumzustand besucht
und mir gesagt hatte, ich solle zu ihm kommen.
Am nächsten Tag herrschte Chaos. Dwarkanath sagte: "Baba ist in
der Nacht gegangen. Wir müssen nach Kainchi gehen."
Eine meiner Lieblingsgeschichten über Maharajji ereignete sich kurz darauf. Ich
hatte nicht viel Geld in Indien, dann schickte mir meine Schwester 400 Dollar
nach Delhi. Auf dem Weg nach Vrindavan löste ich 100 Dollar ein. Ich hatte noch
300 Dollar in Form von 20-Dollar-Reiseschecks. Ich löste (fünfzehn Schecks) ein,
steckte sie in eine Plastikhülle und verstaute sie unten in meiner bestickten
Sadhu-Tasche.
Als ich in Kainchi ankam, mietete ich mir eine Kutir unten bei der Farm. Hin und
wieder fuhr ich nach Nainital, um einen oder zwei weitere Schecks einzulösen.
Ich schaute nie in die Hülle hinein, zählte nie nach, sondern nahm nur ein paar
Schecks heraus und löste sie ein, wenn ich sie brauchte. Schließlich dachte ich
mir, dass nur noch zwei oder drei Schecks übrig sein mussten. Ich ging zur State
Bank of India in Nainital, um alle restlichen Schecks einzulösen, damit ich
nicht mehr nach Nainital fahren musste, um Geld zu wechseln. Ich holte den
Plastikumschlag heraus, in den ich all die Monate nicht hineingeschaut hatte.
Ich zählte die Reiseschecks auf dem polierten Holztresen, und es waren fünfzehn
Schecks – im Wert von 300 Dollar!
Ich wusste, dass ich mit 400 Dollar gestartet war. Ich hatte 100
Dollar in Delhi gewechselt und dann all die Monate lang Schecks eingelöst. Wie
konnte das sein? Ich muss schockiert ausgesehen haben.
Der Herr in der Bank sagte: "Was ist los? Haben Sie Geld verloren?"
Ich spürte, wie die Erde in diesem alten Holzgebäude aus der Kolonialzeit bebte.
Ich sagte: "Könnten Sie das bitte für mich zählen?" "Das sind 300 Dollar. Wie
viel möchten Sie einlösen?"
"Alles."
Als ich mit dem Bus nach Kainchi zurückkehrte, hatte ich einen großen Batzen
Rupien in meiner Tasche. Maharajji gab nicht immer nachmittags Darshan, aber er
war draußen auf seinem Takhat. Als ich über den Hof ging, rief er: "Kya, RamRani,
paisa mil gaya?" Das bedeutet: "Was, RamRani, hast du dein Geld bekommen?" Ich
habe nicht vielen Leuten davon erzählt. Ich war ein wenig paranoid, dass
American Express Baba untersuchen könnte!
Es ist nun über vierzig Jahre her, seit ich Maharaji getroffen habe. Alles in
allem war es eine wirklich wunderbare Reise auf seiner magischen Decke, und Baba
ist überall, die ganze Welt ist kariert! "
Mit deepl übersetzt, orig.
hier
https://www.amazon.de/Love-Everyone-Transcendent-Westerners-Transformed/dp/0062342991

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
04.06.2025 n. Chr. 07.28 Uhr
Blauer Himmel, noch, aber das wird sich in den nächsten paar Stunden wohl ändern,
Dank über Nacht die "Schotten auf", ist es erträglich mit der Temperatur in der Bude ... 21°C. Ein kleiner Schwank vorab. Auf meinem täglichen Weg abends nach Hause, "bergab" in's Dorf steht seit etwa 10 Tagen ein großes Schild links auf der kleinen Rasenfläche zwischen der Strasse und den Häusern, eine Werbung für Europas größtes Mitsubishi-Treffen.
Vorvorgestern noch hatte ich mir angeschaut, wie das nun überhaupt standfest angebracht ist, und hab' gesehen, dass es an Erdspießen aus Stahl (für mobile Elektrozäune) befestigt war. Vorgestern dann - das Plakat ist ja nicht klein - gehe ich halt wieder diesen Weg, und denke mir "wo ist das Plakat ?", drehe mich um, weil ich überlegt hab, ob ich zu weit schon gelatscht bin, aber nix mit Plakat, es war nicht da. Nun, ich ging weiter, überlegte aber noch die Gründe, warum das Plakat wohl vorzeitig entfernt wurde, und kam nur darauf, dass es vielleicht Unstimmigkeiten mit der Stadtverwaltung oder ähnliches gegeben haben muß, weil wegen nicht genehmigt und so. Gestern Abend dann auf dem Weg nach Hause, war es wieder da ...

Und das leitet mich auch gleich auf die Begebenheit von yvette rosser (ramnani). welche ihre 15 Traveller-Checks je 20$ in ihrem Plastikbeutel hatte (1970 war 20$ noch viel Geld, vor allem in Indien), und über ein paar Monate immer mal wieder einen davon einlöste, bis sie dann so langsam an den Punkt gelangte, wo sie sich sagte, dass da jetzt nicht mehr, als ein oder zwei drin sein könnten in der Tüte, und mal hinein schaute. Tja, und was wurde sie gewahr ? Genau, es waren immer noch 15 Traveller-Checks, oder wieder, je nachdem, wie man es sieht.
"ich hatte ein wenig Paranoia, deswegen erzählte ich es nur
ganz wenigen,
weil ich befürchtete, dass American Express gegen maharaj ji vorgehen würde"
yvette rosser (ramnani)
Wir halten alles das für "echt", für uns "gibt" es ja sehr offensichtlich American Express, es gibt einen Vorstandsvorsitzenden, Angestellten Gebäude, Rechenzentren, das kann man alles live aufsuchen, anfassen, das muß echt sein. Doch nun sorgt maharaj ji dafür, dass yvette ihre Traveller Checks nicht weniger werden, obwohl sie diese über die Monate immer mal wieder einlöst. So kann also maharaj ji machen, dass es bei American Express nicht auffällt, wenn anstelle der ausgegebenen 15 Checks auf einmal 28 eingelöst werden, von denen 13 demnach nie existiert haben ? Hier berühren wir jetzt einen Punkt, welchen ich in anderen Zusammenhängen schon oft erwähnt habe (allerdings mehr im Gespräch), dass "Institutionen", Organisationen eben auch nur scheinbar über diese Größe, Macht und Akkuratesse verfügen.
Denn wir sind wie Baumstämme im Schnee. Scheinbar liegen sie glatt auf, und mit kleinem Anstoß sollte man sie wegschieben können. Nein, das kann man nicht, denn sie sind fest mit dem Boden verbunden. Aber sieh, sogar das ist nur scheinbar.
franz kafka, die Bäume
So hatte ich das in meiner Jugend mal erlebt, dass ich von einer stringent operierenden Institution anscheinend - zu meinem Vorteil - vergessen worden bin. Nie konnte ich mir das erklären, weil die ganze Geschichte war "zu dick", als dass sie hätte unter den Tisch fallen können, ohne eben dort auch bemerkt werden zu können. Und in ähnlicher Richtung gab es noch ein paar andere Fälle, wo ich mich gefragt hab, wie das angehen kann. Wer kein Englisch kann, aber das Glück hat, noch dieses Buch ergattern zu können, wird viele Beispiele lesen dürfen, in welchen maharaj ji große "Organisationen" oder "Institutionen" wie eine Fata Morgana aussehen lässt. Wie eine Organisation in einem Traum.
Suche nach: Subtil ist der Pfad der liebe (von ram dass)
Hier liegt wohl überhaupt unser Denkfehler, dass wir einfach glauben "es gibt" dieses oder jenes, nur weil wir die Gebäude dieser Firmen aufsuchen, dort die Angestellten, das angeschlossene Rechenzentrum sehen, anfassen können. Oder gar noch selbst dort arbeiten.
Nur was erlebt "neo" denn faktisch (im Film), was erleben wir recht deutlich im Traum ? Richtig, Information wird durch Bewusstheit wahrgenommen. Genau genommen lässt sich Bewusstheit von Information garnicht trennen. Im Film geht neo zur arbeit, es gibt die Gebäude, die Mitarbeiter, Computer, Fahrstühle, die "Firma", nur letzten Endes ist das Alles eben, inklusive des Straßenzuges, der Stadt, des Landes, der "Welt" nicht mehr als unterschiedliche Form von information. Abgesehen davon, dass man den Strassenzug, die Stadt, die "Welt" ohne nichts als solche wahrnehmen kann, und wenn ja, dann eben nur stark ausgezoomt, wo das Detail verloren geht. Die große Firma, für die Neo arbeitet - wie "echt" ist diese als solche ? Was ist in ihr möglich, was nicht ? Nun, die Antwort kann man sich leicht geben - schlicht alles ist möglich, denn Alles, inklusive den Menschen, den Gebäuden, dann der Stadt, in welcher die Gebäude stehen, des Landes, in welcher sich die Stadt, der Welt, in welcher sich das Land, des Universums, in welcher sich die Welt befindet, ist nicht mehr, als Fiktion, und faktisch auch überhaupt nicht dort generiert, wo es "Statt zu finden" scheint, sondern "in other" (edward fredkin)
Der "Fehler", oder besser die Dichotomie, welche ich bei edward fredkin, aber auch anderen, dann desöfteren wahrnehme, ist eben die Inkonsistenz, dass man von hier aus etwas "kausal" bewirken könne. Doch keine Figur, kein Staat, keine Atombombe im Computergame beeinflusst irgendwie das Programm, noch kann es beeinflussen, denn das Programm, oder der Rechner rendert ja erst das Ganze, die Stadt, das Gebäude, den Fahrstuhl, den Chef, die Atombombe. Was immer hier geschieht - ist schon lange geschehen, nicht als solches, und auch nicht hier.
"ich hatte ein wenig Paranoia, deswegen erzählte ich es nur
ganz wenigen,
weil ich befürchtete, dass American Express gegen maharaj ji vorgehen würde"
yvette rosser (ramnani)
American Express ist genauso echt wie die Firma, für welche Neo (im Film) arbeitet. Eine gerenderte Firma, in einem gerendertem Gebäude, einer gerenderten Stadt, und so weiter, und so fort. Nur eine Figur ohne irgendeine Bühne, irgendeinen Inhalt ergeben nunmal keine gescheite und glaubhafte Illusion ....

So ist's schon viel besser, satt mit Inhalt gefüllt ...


|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
06.06.2025 n. Chr. 07.46 Uhr
Seit 05.30 Uhr wach, über 2 Träume nachgedacht, dann ergab eine Überlegung die nächste, das war's dann mit Schlaf. Der eine Traum war etwas wehmütiger Natur, der andere mehr enttäuschend, doch beide hätten sie auch dem ganz normalen Alltag entnommen sein können.
Nur kurz hier gleic die Definition eines NPC
von tom campbell, welche ich so (klar) noch nicht von ihm gehört habe, und zwar
ist für ihn ein NPC, welcher hier keine Geburt, kein "Tod`" hat, sondern stellt
euch vor, jemand tritt in euer leben, sei es für ein paar Minuten, Stunden,
Wochen, Monate oder gar Jahre (aus gewissen Gründen der jeweiligen Entwicklung
des Einzelnen), und dann ist sie, er, wieder aus unserem leben entschwunden.
Diese Figur ist dann eben nicht irgendwann "geboren" worden, und "stirbt" Jahre
oder Jahrzehnte später, sondern ist einfach "systemgeneriert". Soll heißen, in
den Strom unserer Daten, welcher für uns der "lebenslauf" ist, mit eingefügt um
uns etwas zu lehren, was wahrscheinlich durch einen PC aufgrund des freien
Willens nicht so einfach und effizient gelehrt hätte werden können.
Im Grunde hätte man dann bei einem NPC also mit gott selbst zu tun. Denn von
niemand anderem stammt ja diese Figur, und von niemand anderem wird sie
gespielt. Da aber Lehren und Lektionen in den meisten Fällen durch etwas zu
Stande kommen, was wir nicht wollen, sondern halt "da durch müssen", wird klar,
worauf die liebe gottes gerichtet ist - dass wir dazu lernen, wie tom sagt, ein
wesen von geringerer Entropie werden.
So war meine Theorie zum NPC bisher nicht davon abhängig, ob jemand hier "geboren" wurde, oder mittendrin für einer gewisse Aufgabe "hinein programmiert". Doch ich rechne tom in dieser Hinsicht einfach mehr wissen zu, und so wäre seiner Aussage gemäß ein jeder, welcher dieses zähe leben ganz von Anfang an mitmachen muß, ein regulärer Teilnehmer hier unten, im "spiel des lebens" (Player/iuoc).
Auch hatte ich mir noch Gedanken gemacht über die Hochzeit in Indien, vielleicht um 1970, in einem abgelegenen Dorf oder vielleicht nur sogar Siedlung mit ein paar Häusern, ohne jeglichen Strom, wo maharaji ji für die Dauer der Hochzeit, also 2 Tage, das Wetter von Bullenhitze auf angenehme, für diese Gegend "winterliche" Temperaturen senkte. Und ich fragte mich, ob das einfach ein Radius um den Ort der Hochzeit war, oder, um der Plausibilität willen, zufällig ein ganz ungewöhnlicher Strom von Kaltluft über diesen Landstrich zog. Doch Letzteres bring viele Probleme mit sich, denn solch außergewöhnlichen Temperaturen erreicht man plausibel nur über den Import aus kalten Regionen, und das muß dann schnell gehen, also muss starker Wind/Sturm bei sowas mit involviert sein. Jetzt muß man aber auch noch bedenken, in einer abgelegenen Siedlung in Indien auch noch ohne Strom, und das 1970 vielleicht wird es keine Wettervorhersage gegeben haben, außer vielleicht von den Viehtreibern vor Ort, Bauern oder eben anderen, welche das Wetter vorausschauend beobachten müssen. Soll heißen - da ist reichlich ! Raum für Unschärfe. Und wenn dann auch niemand nach der Hochzeit Zuhause, vielleicht weiter entfernt, die Bekannten, Nachbarn danach fragt, was sie den für ein Wetter erlebt haben, also eine systematische "Messung" durchführt, sozusagen - denn erhöht sich die Unschärfe natürlich nochmals.

Auch sollte man natürlich nicht vergessen, dass es "die Siedlung", "die Temperatur" ja als solche nie gab. Also der "Aufwand" eine Hochzeit mit 23°C zu rendern, ist der gleiche, wie bei 43°C. Auch "Temperatur" ist information, wie etwa das so solide erscheinende Molekül Phthalocyanine letztlich nur information ist.
Wie sich dann bei genauerem Hinsehn heraus stellt ...
Ja, es ist wirklich so, dass man einfach alles unter einem völlig anderen Blickwinkel betrachten muß, wenn man die Dinge hier nach ihrem wahren Wesen begreifen möchte ...
https://www.instagram.com/sonu_suthar18/p/DAEBqA3MXHZ/


|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
07.06.2025 n. Chr. 08.25 Uhr
Spät dran, nur etwas blabla.
Von den empirischen Fakten her (DSE, DQCEE) ist es schon länger klar, dass diese wirklichkeit letztlich nicht "von hier" ist, meint - sich nicht aus sich heraus "hier" generiert. Also "ist" diese wirklichkeit nicht in wirklichkeit hier, sondern es scheint nur so, als spielte sie sich hier ab.
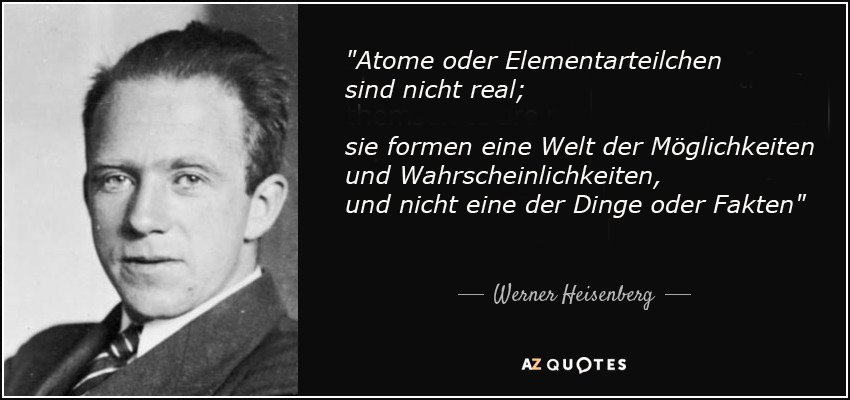
In jüngster Zeit dann (2015 ANU Physiscs-tuscott) dann auch noch in den Experimenten klar wurde, dass dasjenige, wovon man ausgeht, dass es vom Emitter zum Detektor einen Weg beschreitet - gar nicht existiert, als: es wurde nie von irgendwas ein Weg beschritten !
Es gibt das Ergebnis am Detektor.
Und dennoch hat nie ein "etwas" einen Weg zurück gelegt vom Emitter dorthin.
Keine "Welle", kein "Teilchen", nichts ...
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
Prof. tuscott, Australian National University, 27 Mai 2015 Link
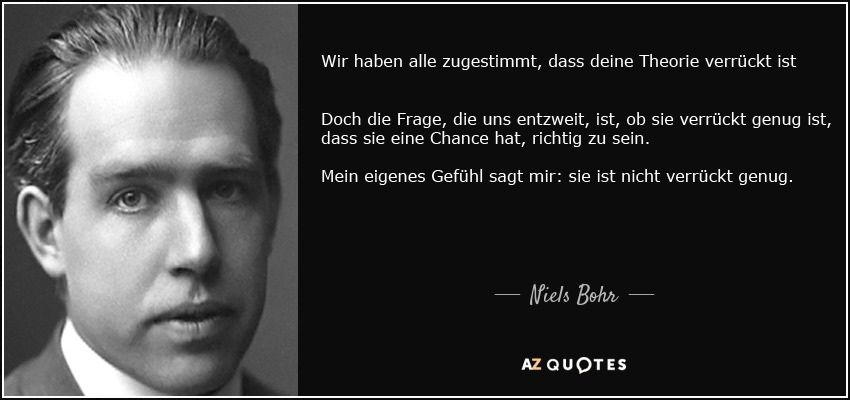
Die Physik sagt uns also, dass es keine Physik gibt, sondern nur so etwas wie eine Scheinphysik, welche - im übertragenen Sinne - welche die Dinge, welche im Videogame passieren, aus dem Videogame selbst heraus zu erklären versucht. Bis hin zu scheinbar profanen Erklärungen, dass die Ernte gut ist, weil ...
So kenne ich kaum einen, welcher nicht permanent den Fehler begeht, diese wirklichkeit aus sich selbst heraus erklären zu wollen. Zwar ist es unbestritten, dass es die allermeiste Zeit so scheint, als ob wirklichkeit auch faktisch "hier" Statt findet, doch hat diese An sich eben seit dem DSE keinen Bestand mehr. Also seit über 100 Jahren. Auch als luca mit valentin hier war, man redete, diskutierte, deutlich war es immer wieder zu hören, zu spüren, wie tief diese (sozialistische ?) "Indoktrination" beim Menschen sitzt. Da kann man zwar vorgeben, Dinge verstanden zu haben, doch das dieses Verständnis noch nicht einmal im Ansatz in Fleisch und Blut übergegangen ist, zeigt sich dann doch recht schnell, weil es einfach zu tief sitz, die Auffassung nämlich, dass wirklichkeit faktisch auch "hier" Statt findet.
Und da sie eben nicht "hier" Statt findet, ist "hier" auch garnicht der Grund für irgendwas zu suchen, geschweige denn zu finden. Wenn dieser LKW nun umkippt, tut er das aufgrund der Schwerkraft, des lockeren Bodens, seiner Masse ?
Wäre wirklichkeit "physisch" und geschähe "hier" - es gäbe die Ergebnisse des DSE, DQCEE und eben der zahlreichen anderen Experimente nicht. "Materie" würde sich verhalten, wie Materie, und eben nicht wie ein statistischer Prozess, welchem jegliche "Materialität" abhold ist. Das deutlichste Zeichen überhaupt, dass diese wirklichkeit sekundär ist, und in einen faktischen Sinne sich hier garnicht abspielt, sondern bloß abzuspielen scheint. Im existentiellen Sinne von "sein", ist wirklichkeit nicht "hier", auch eben, wenn es jede Sekunde so scheint, als ob.
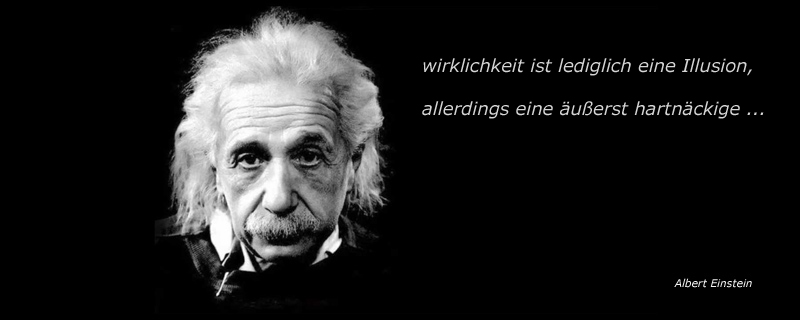
Für mich war es wohl DER Durchbruch überhaupt in diesem
Durchgang, die Freigabe erhalten zu haben, die Implikationen des DSE, DQCEE und
eben auch der anderen Experimente verstanden zu haben. Diese brauchen noch nicht
einmal in Fleisch und Blut übergegangen zu sein, es reicht erstmal, allein von
der Verstandesseite, zu wissen, dass man sich
A: in einer Art Traum befindet, und
B: dass hier wirklich alles, aber auch alles, super-einfach möglich ist, selbst
dasjenige, was man nicht einmal zu denken fähig ist.

"Sitzt" dieses Wissen nur erstmal von der Verstandesseite, geht man natürlich mit Dingen, welche die allermeisten Anderen für unmöhlich halten, ganz anders um. "Die Anderen" halten diese Dinge, Vorkommnisse, Begebenheiten ja nur deshalb für unmöglich, weil sie noch immer glauben, wirklichkeit sein physisch, und vor allem, dass sie sich faktisch "hier" abspielt. Wie eben das multi Player online Game nicht von den jeweiligen Monitoren generiert wird, sondern halt vom "Großrechner", welcher die jeweiligen daten nur für individuellen Monitore generiert. Zu Zeiten von heisenberg, bohr, einstein, planck etc. war es noch nicht möglich, solche Metaphern zu bilden, und den Aufbau von wirklichkeit - in einer Analogie - schematisch recht verständlich machen zu können. Doch heute geht es doch recht gut, dank der Erfindung (??) des "Computers", welcher ja nur das Diskrete kennt, die "Einheit" (Bit). Ob wir nun eine schöne Landschaft auf dem Monitor sehen, etwas Geschriebenes, egal was auch immer "computet" wurde - es besteht aus ein und demselben Zeugs.

So hartnäckig sich auch wirklichkeit als "hier" Statt findend präsentiert - letztlich sie nicht darüber hinweg täuschen kann, das das bloß eine Illusion ist. "Gehostet" ist sie sozusagen im Zentralrechner, oder - wenn man es so benennen möchte - im geiste gottes. Wenn wir von "sein" sprechen wollen, dann spielt es sich "dort" ab ...
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
07.06.2025 n. Chr. 08.25 Uhr
Spät dran, nur etwas blabla.
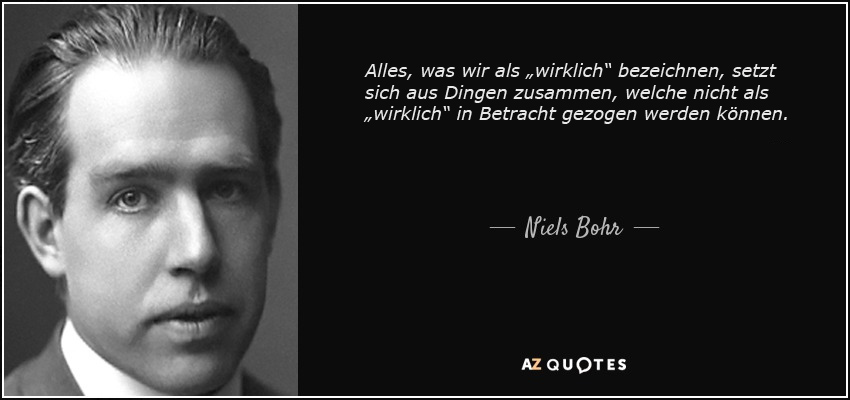
Von den empirischen Fakten her (DSE, DQCEE) ist es schon länger klar, dass diese wirklichkeit letztlich nicht "von hier" ist, meint - sich nicht aus sich heraus "hier" generiert. Also "ist" diese wirklichkeit nicht in wirklichkeit hier, sondern es scheint nur so, als spielte sie sich hier ab.
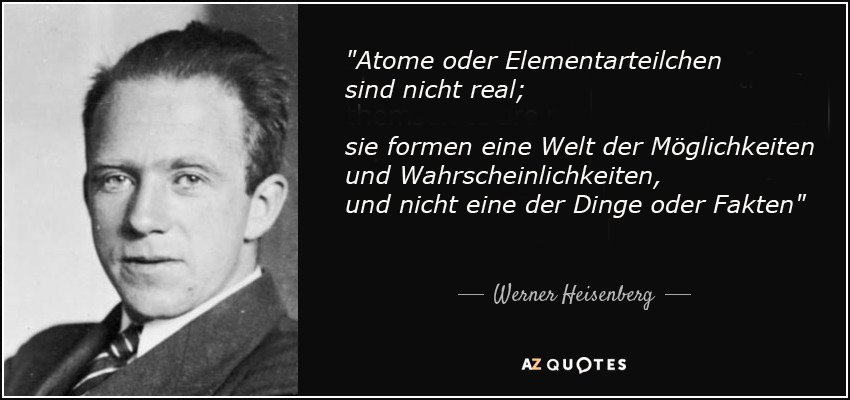
In jüngster Zeit dann (2015 ANU Physiscs-tuscott) dann auch noch in den Experimenten klar wurde, dass dasjenige, wovon man ausgeht, dass es vom Emitter zum Detektor einen Weg beschreitet - gar nicht existiert, also: es wurde nie von irgendwas ein Weg beschritten !
Es gibt das Ergebnis am Detektor.
Und dennoch hat nie ein "etwas" einen Weg zurück gelegt vom Emitter dorthin.
Keine "Welle", kein "Teilchen", nichts ...
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
Prof. tuscott, Australian National University, 27 Mai 2015 Link
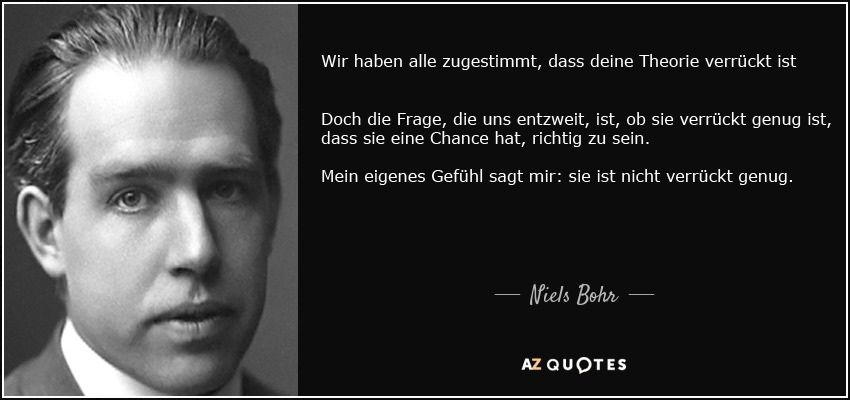
Die Physik sagt uns also, dass es keine Physik gibt, sondern nur so etwas wie eine Scheinphysik, welche - im übertragenen Sinne - die Dinge, die im Videogame passieren, aus dem Videogame selbst heraus zu erklären versucht. Bis hin zu scheinbar profanen Erklärungen, dass die Ernte gut ist, weil ...
So kenne ich kaum einen, welcher nicht permanent den Fehler begeht, diese wirklichkeit aus sich selbst heraus erklären zu wollen. Zwar ist es unbestritten, dass es die allermeiste Zeit so scheint, als ob wirklichkeit auch faktisch "hier" Statt findet, doch hat diese Ansicht eben seit dem DSE keinen Bestand mehr. Also seit über 100 Jahren. Auch als luca mit valentin hier war, man redete, diskutierte ... deutlich war es immer wieder zu hören, zu spüren, wie tief diese (sozialistische ?) "Indoktrination" beim Menschen sitzt. Da kann man zwar vorgeben, Dinge verstanden zu haben, doch das dieses Verständnis noch nicht einmal im Ansatz in Fleisch und Blut übergegangen ist, zeigt sich dann doch recht schnell, weil es einfach zu tief sitzt, die Auffassung nämlich, dass wirklichkeit faktisch auch "hier" Statt findet.
Und da sie eben nicht "hier" Statt findet, ist "hier" auch garnicht der Grund für irgendwas zu suchen, geschweige denn zu finden. Wenn dieser LKW nun umkippt, tut er das aufgrund der Schwerkraft, des lockeren Bodens, seiner Masse ?
Wäre wirklichkeit "physisch" und geschähe "hier" - es gäbe die Ergebnisse des DSE, DQCEE und eben der zahlreichen anderen Experimente nicht. "Materie" würde sich verhalten, wie Materie, und eben nicht wie ein statistischer Prozess, welchem jegliche "Materialität" abhold ist. Das deutlichste Zeichen überhaupt, dass diese wirklichkeit sekundär ist, und in einen faktischen Sinne sich hier garnicht abspielt, sondern bloß abzuspielen scheint. Im existentiellen Sinne von "sein", ist wirklichkeit nicht "hier", auch eben, wenn es jede Sekunde so scheint, als ob.
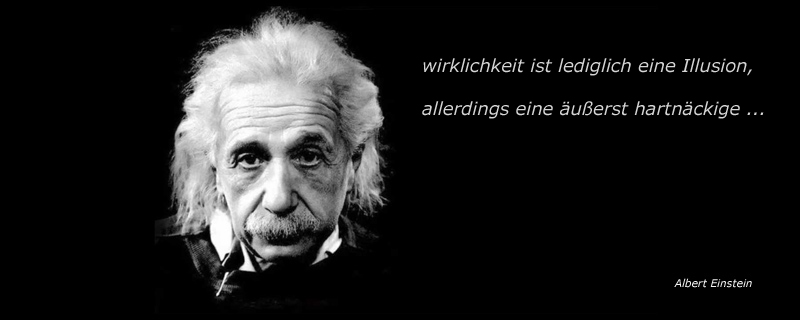
Für mich war es wohl DER Durchbruch überhaupt in diesem
Durchgang, die Freigabe erhalten zu haben, die Implikationen des DSE, DQCEE und
eben auch der anderen Experimente verstanden zu haben. Diese brauchen noch nicht
einmal in Fleisch und Blut übergegangen zu sein, es reicht erstmal, allein von
der Verstandesseite, zu wissen, dass man sich
A: in einer Art Traum befindet, und
B: dass hier wirklich alles, aber auch alles, super-einfach möglich ist, selbst
dasjenige, was man nicht einmal zu denken fähig ist.

"Sitzt" dieses Wissen nur erstmal von der Verstandesseite, geht man natürlich mit Dingen, welche die allermeisten Anderen für unmöglich halten, ganz anders um. "Die Anderen" halten diese Dinge, Vorkommnisse, Begebenheiten ja nur deshalb für unmöglich, weil sie noch immer glauben, wirklichkeit sein physisch, und vor allem, dass sie sich faktisch "hier" abspielt. Wie eben das multi Player online Game nicht von den jeweiligen Monitoren generiert wird, sondern halt vom "Großrechner", welcher die jeweiligen daten nur für individuellen Monitore generiert. Zu Zeiten von heisenberg, bohr, einstein, planck etc. war es noch nicht möglich, solche Metaphern zu bilden, und den Aufbau von wirklichkeit - in einer Analogie - schematisch recht verständlich machen zu können. Doch heute geht es doch recht gut, dank der Erfindung (??) des "Computers", welcher ja nur das Diskrete kennt, die "Einheit" (Bit). Ob wir nun eine schöne Landschaft auf dem Monitor sehen, etwas Geschriebenes, egal was auch immer "computet" wurde - es besteht aus ein und demselben Zeugs.

So hartnäckig sich auch wirklichkeit als "hier" Statt findend präsentiert - letztlich sie nicht darüber hinweg täuschen kann, das das bloß eine Illusion ist. "Gehostet" ist sie sozusagen im Zentralrechner, oder - wenn man es so benennen möchte - im geiste gottes. Wenn wir von "sein" sprechen wollen, dann spielt es sich "dort" ab ...
Warum wird es hell ?
Weil die Sonne scheint ?
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
08.06.2025 n. Chr. 08.42 Uhr
Zu spät dran, aber gleich wird es eh duster und regnerisch für vielleicht 2 Stunden, also kann ich auch etwas tippen. Die Rubrik "physisch (erklärbar) ist: garnichts" ist eine meiner Lieblinge, weil sie das größte (scheinbare !) Paradox mit sich bringt, wie sollen Dinge nicht "physisch" sein, wenn sie doch alles andere, als nicht physisch wirken, und uns obendrein auch nicht einmal irgendwas bekannt ist, was nicht physischer Natur wäre. Oder ich sage mal so, hier haben wohl einige schon Begebenheiten erlebt, welche mit "Physis" nichts mehr zu tun haben (können), doch die überwältigende Mehrheit der menschen ist einfach davon überzeugt, dass diese wirklichkeit hier dinglich ist, also aus den viel gepredigten Molekülen, Atomen, Wellen, Energien und so fort, sich zusammensetzt, respektive generiert. Wie viele menschen sind fest davon überzeugt, dass die Sonne die Ursache der Helligkeit hier ist ? Sogar die allermeisten Inder !
Aber klar, warum sollte man auch so in's Detail gehen, für die hinduistischen, buddhistischen und ähnliche Auffassungen von wirklichkeit reicht es einfach, wenn man sich letztlich klar wird, dass das hier vom wesen her ein Traum ist, und das gesamte Gebilde Maya (Illusion). Doch ähnlich wie tom campbell richte ich mich nunmal auch überwiegend an diejenigen, welche aus der Logik und Empirie heraus das Ganze hier mehr verstehen, als glauben wollen. Also dien Komplex, den wir "wirklichkeit" nennen, inklusive unserer eigenen Wenigkeit.
Natürlich geht es nicht nur über Worte und Begriffe, auch ein Pilz, ein Kaktus, ein Gebräu aus Lianen, eine OBE oder NDE kann uns davon überzeugen, dass diese wirklichkeit keine absolute, sondern bloß eine relative ist, also sekundär, nicht primär - doch sooo viele haben das Glück oder den Mut, respektive Hartnäckigkeit nicht. Und, das nun sich ergebende, vollkommen entgegen gesetzte Verständnis von wirklichkeit lässt sich dann zwar erzählen, doch der andere kann es mangels Erfahrung nicht objektiv nachvollziehen, und ist demgemäß dann wieder auf den Glauben angewiesen.
Das hier ist dann schon etwas ganz anderes - ich kann es mitteilen :
Außerdem gehören zu den Experimenten dann auch noch Dokumentationen, Publikationen, und dann kann der logische geist sich selber auf den Weg machen, um die Korrelationen wie Implikationen aus etwa den Experimenten sich zu erarbeiten. Ob man dann scheitert, und sagt "es ist halt schräge "Physik" (weird Physics), und dann zum Tagesgeschehen über geht, oder man es schafft, einen vollständigen Paradigmenwechsel erleben zu dürfen, hängt dann wohl mit Hartnäckigkeit, logischem Durchdringungsvermögen, vielleicht aber auch einfach nur "Gnade" zusammen, weil der Weg durch das leben eben so zu sein hat, oder sein soll.
Prinzipiell, also der Möglichkeit nach also kann sich ein jeder, anhand der vor uns liegenden Empirie, davon überzeugen, dass er sich hier in einer art Traum befinden muß, in welchem wir ja auch Alles sich Abspielende als illusionär bezeichnen - nachdem wir dann (wieder) aufgewacht sind.
Gibt es also ein leben vor dem Tod ?
Von der Logik her sollte es weniger illusionär sein, wenn wir dann endlich wieder aus der Rolle hier heraus kommen. Wie es den Film gibt, welcher 100% Illusion ist, doch eben die Dreharbeiten dazu schon einen echteren Charakter aufweisen. Geht man noch weiter, gelangt man an einen kleineren Stab von menschen, welche für diese Dreharbeiten verantwortlich sind, und noch weiter gibt es dann einen, der sich das Ganze überhaupt ausgedacht hat, in dessen geist der gesamte Film, mit Hauptdarsteller, Dramatik und pipapo, seinen Ursprung hatte. Und nicht wenige Filme es mittlerweile gibt, in welchem der Hauptdarsteller auch derselbe ist, welcher sich den gesamten Film auch ausgedacht hat - mit all seinen spannenden Herausforderungen, Schwierigkeiten, überraschenden Momenten, Hochs und Tiefs. Von der Metapher her, glaubt man etwa christian sundberg, aaron greene und auch anderen, sind wir damit relativ nahe dran, wie es zu unserem "Film" gekommen ist.
So hat das tom vor kurzem gesagt, wer halt nicht soviel lernen möchte, der sucht sich ein leben in einer Mittelstandsfamilie im ruhigen Vorort aus, es läuft relativ behütet, meist nach Wunsch, man hat später selber seine zweikommadrei Kinder und 1,7 Autos, schließlich ist der Durchgang dann auch vorbei - doch rumgekommen ist wenig bis garnichts. Kaum Punkte gesammelt.
"Das war mir eine Lehre", sagt man ja auch ganz freimütig heraus, da ist also eine Situation gewesen, welche wie ein Lehrer fungiert hat, nur eben, dass diese Lehre sich (scheinbar) ganz ungezwungen im normalen lebenslauf "so ergeben" hat. Man hat: gelernt. Hat es beim multi Player online Game zum Ableben geführt, ist man kurzzeitig verärgert, weil es nicht mehr weiter geht, und man vielleicht auch "grad so im Fluss" war, doch das legt sich schnell, man weiß jetzt, was so ungefähr der Fehler war, und setzt auf ein Neues an.
Wie gut man durch die Kulisse kommt, hängt also von dem Maße ab, wie man dazu lernt.
Natürlich immer auf der Basis des Schwierigkeitsgrades, welchen man gewählt hat. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Punkte. So hat siddhi ma ram dass ein Mantra angeboten, welches ihn aus dem Rollstuhl wieder heraus holt, und er wieder gehen kann. Doch er wollte nicht, und pflegte zu krishna das zu sagen, dass der Schlaganfall und die damit einhergehende Lähmung sein leben gerettet haben (also seinen Durchgang, da ja halt dann doch noch ordentlich Punkte zusammen kamen). So hat sich, genau wie ich es vor Jahren schon beschrub, tom campbell kürzlich zu christopher reeve geäußert - ein äußerlich krass zusammengestelltes leben, von buchstäblich Superman, zur Querschnittlähmung und Jahren noch im Rollstuhl mit schwerster Behinderung, doch eben er in dieser Zeit noch enorm ! an Einsicht gewann. Auch ihm haben sozusagen die letzten Jahre noch "das leben gerettet", also enorm Punkte einfahren lassen. Wie ram dass hatte auch er diesen "Schicksalsschlag" als Chance gesehen - und sie auch genutzt.
https://www.amazon.de/Immer-noch-ich-Christopher-Reeve/dp/3795117097
|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
12.06.2025 n. Chr. 07.47 Uhr
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
Prof. tuscott, Australian National University, 27 Mai 2015 Link
Die Bude hält sich bei noch 22°C, mal sehen, wie es sich die
nächsten Tage und Wochen gestaltet. Jedenfalls, das habe ich gerade gemerkt,
funktioniert die Sonnenautomatik der Markise, sie fährt automatisch aus, ab
einem gewissen Level von Helligkeit. Ja ich weiß, satan hat auch bei mir noch
einen Fuß in der Tür, wenn ich auch meine Bequemlichkeiten in Grenzen zu halten
suche. Nach wie vor gibt es hier eine Geschichte, die jeden Tag überschattet,
so, dass es auch auf die Stimmung schlägt, wenn man nicht aufpasst, und gestern
war es dann soweit, wohl auch dank des guten Wetters, dass ich mich dringend
wieder so richtig daran erinnern musste, dass ich hier in einem Traum stecke,
also dass es hier nicht wirklich wirklich ist - das hellt einfach meine Laune
auf.
Und was macht man da am besten ?
Genau ...
Wer kein Exemplar im Antiquariat oder sonstwo mehr
ergattern kann, ein
Download Link:
hier
Kann man ja ausdrucken, und sich dann selbst ein Buch zusammen basteln.
Einfach nur ein wenig lesen, das reicht schon. Da habe ich dann auch für heute und die nächsten Tage ein paar Begebenheiten photographiert. Im Grunde könnte (oder sollte ?) ich hier jeden Tag eine bringen, doch die Disziplin habe ich nicht. Heute kommt dann auch noch ein "Incoming", ein Workshop mit krishna das in Yogaville, in welchem sehr gute Fragen gestellt werden, und auch noch ein paar kleinere Details zu maharaj ji's letztem Tag enthalten sind, welcher ja recht mysteriös ist. Denn erstens ist er weggefahren (hat sich fahren lassen), die allerengsten Vertrauten (siddhi ma und kc tewari) durften auch nicht mit, und so weiß man halt grob nur, dass er den Ashram verlassen hat, und nicht mehr zurück gekehrt ist. Doch wo ist er denn hin ? In diesem Workshop erwähnt krishna das noch ein paar weitere Details, welche so langsam ein Bild ergeben. Es sieht so aus, als ob maharaj ji unter einem Vorwand das so "gedreht" hat, dass niemand im Ashram den Übergang mitbekommen, und alles ganz natürlich plausibel nach außen hin aussehen sollte. Also das Gegenteil von dem, was paramahansa yogananda gemacht hat. So maharaji ji wohl den unauffälligsten mahasamadhi begangen hat, welchen man sich vorstellen kann.
Der Fahrer, welcher maharaj ji abholte, wollte seine Transportfähigkeit vorher ermitteln, und fühlte seinen Puls. Er hatte keinen Puls. Der Fahrer sagte dann, dass er ihn nicht transportieren kann, wenn er keinen Puls hat. Dann maharaj ji meinte: "jetzt nochmal" und den Arm hinstreckte, da hatte er dann wieder Puls. Sein letztes "offiziell irdisches" lila, was die Devotees noch mitbekommen durften ...
Und ja, es ist wirklich so, dass mich jedenfalls nur eine Seite bereits in dem Buch mich wieder "in die Spur" bringt. Es ist alles so dermaßen überzeugend "echt" hier, oder besser: als hier, dass es immer wieder der Erinnerung und aber auch Anstrengung bedarf, sich klar zu werden darüber, dass man letztlich in einem Traum sich befindet, oder eben einer "divine reality", einer göttlichen wirklichkeit.
Wo ist das denn anders möglich, als in einer solchen wirklichkeit ...
Ja, auch "ram" stand noch "graviert" auf der Innenseite der Rinde der Bäume, wie auf jedem Blatte, jedem Ast.
Immerhin scheint diese Region bei Kamtanath, oder Teile davon, unter Schutz zu stehen:
Natürlich kann man heute auch nach Kamtanath fahren, sich die Ramkulla-Bäume anschauen, man wird nichts Eingraviertes auf den Blättern oder Ästen finden, weil so funktioniert wirklichkeit nicht.

Eleusis bewahrt etwas, was es bloß dem Wiederkehrenden zu zeigen vermag.
Auch spielt natürlich das "plausible-Deniability"-Prinzip mit hinein, was wäre das hier für eine inkonsistente wirklichkeit, die sich auf der einen Seite äußerst ernst und seriös geben will, und dann aber bräuchte man nur irgendwohin zu fliegen, um sich davon überzeugen zu können, dass es hier letztlich doch nur virtuell, doch nur ein Traum ist ? Das "plausible-deniability" Prinzip hängt auch mit dem no free lunch Prinzip insofern zusammen, dass im Grunde keinem, welcher nicht an die Tür klopft, geöffnet wird. Wer unbedingt glauben will, oder felsenfest davon überzeugt ist, dass die Vorstellung hier echt ist, dem wird nichts offenbart (bis auf Ausnahmen, OBEs, NDEs oder auch irdische Geschichten, siehe oliver lazar).
So haben wir denn auf der einen Seite diejenigen, welche sich mühen um wirklichkeit, sich auch spirituell betätigen, und doch nie einen deutlichen Hinweis auf die Natur von wirklichkeit erhalten, und auf der anderen Seite dann die äußerst mondänen (weltlichen) Charaktere, felsenfest glaubend, dass das hier der wahre Jakob ist, welche dann aus heiterem Himmel auf einmal diese Art Gnade erleben zu dürfen, dass sie dann doch "nur" in einem online Game stecken, und soooooo ernst das Ganze nun auch nicht zu nehmen ist. Warum viele der Mühenden keinen Hinweis bekommen, und andere wiederum ohne jegliches Zutun gleich einen Wink mit der Zaunlatte erhalten, werden wir wohl nicht ergründen können. Man denke an den Vater der OBE's, robert monroe. Wie zufällig ist es, das tom campbell in der Nähe eine Arbeitsstätte erhält, und dann auch noch zufällig sein Boss das Buch von robert liest, und dann noch zufällig tom fragt, ob er der Sache nicht mal auf den Grund gehen möchte, und dann zufällig robert bereits eine Art Labor rudimentär eingerichtet hat, und zufällig auf der Suche nach Wissenschaftlern, als er die Anfrage von tom erhält (auf Drängen des "Chef's").
https://www.amazon.de/s?k=B%C3%BCcher-Robert-A-Monroe
So, jetzt will ich aber niemanden mehr langweilen :-)


|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
19.06.2025 n. Chr. 08.16 Uhr
Den Youtube Kanal von eke acres habe ich mal abonniert, wenn sich da etwas Spannendes ergibt, werde ich das natürlich hier berichten.
Later when he lived at the Indian village of Neeb Karori, he was called Neeb Karori Baba by the local villagers. There is a lot of confusion about the spelling of 'Neeb Karori'. Neeb Karori is the phonological translation of the same word from Hindi. Neeb is also sometimes written as Nib and Karori is sometimes written as Karauri. The 'ee' in Neeb is to be pronounced as in 'speed' and the 'o' in Karori is to pronounced as the 'a' in 'raw'. It is to be noted that the name Neeb Karori was taken up by Maharajji himself. He has signed with this name at some places. Neeb (In pure hindi - neev) means foundation and Karori (in pure hindi - karari) means strong. So Neeb Karori means a strong foundation.
http://www.neebkaroribaba.com/maharajji.html
Nach wie vor verbringe ich so um die 2 Stunden am Tag in irgendeiner Weise mit maharaj ji, oder krishna das. Lauschend, lesend, wie auch immer. Da bleibt immer noch genug Zeit über für Anderes, etwa einen Seitenblick zu werfen, was "da draußen" so vor sich geht, oder besser: zu gehen scheint. Allerdings viel Zeit muß dort nicht investiert werden, 10 Minuten reichen, um die Schlagzeilen des Mainstreams, wie auch der "Truther"szene zu überfliegen. Interessant zu beobachten ist jedenfalls, wie viel man dort zu wissen scheint, also in beiden Fraktionen. So habe ich über die letzten Jahre das ganze Äußere hier mehr und mehr als Bühne begreifen dürfen, welche in kleinster Art und Weise in den Händen derer liegt, welche uns Glauben gemacht werden. Auch nicht irgendwelchen mehr oder minder okkulten Organisationen. Das ist alles Smokescreen, das sind alles Plausibilitäten, die Bühne hier wird nur von einer Seite her bestellt.

Also von göttlicher Seite, wenn man so will. Daher es letztlich dann auch überflüssig ist, das "da draußen" wissen oder beeinflussen zu wollen. Das hatte siddhi ma mal zu krishna das gesagt: "it is all Grace, but we should act, as if it is'nt"
Da wären wir dann wieder hier ...

Der Verlauf des lebens also letztlich nicht in unseren Händen liegt, wir aber so handeln sollten, als sei es so, als läge der Looping, die steile bergab oder bergauf-Fahrt in unserer Hand. Doch das hatte ich auch schonmal geschrieben, es kann uns doch am langen Ende auch egal sein. Es wirkt hier halt so super-echt, dass nahezu keiner umhin kann, es hier so wahrzunehmen, als sei man ein aktiver Player hier auf der Bühne. Doch schon aus logischen Erwägungen heraus kann das natürlich nicht angehen, da diese wirklichkeit, welche wir
als
"hier" erleben, faktisch eine Illusion sein muss.
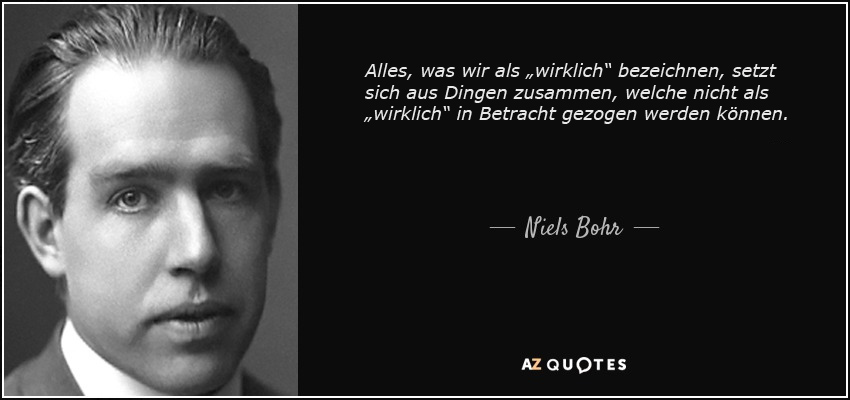
Da eben diese "hier"-wirklichkeit faktisch "in other" (edward fredkin) gerendert, erzeugt oder "gehostet" sein muß, und also ein sekundäres Phänomen ist, ist es einfach müßig, zu glauben, dass man "hier" etwas macht, oder beeinflusst, oder oder, also dass hier überhaupt in dem Sinne von geschehen auch nur irgendwas geschieht. In dem Sinne, in welchen wir "Geschehen" verstehen, geschieht "hier": garnichts. Ebenso wenig, wie ein multi Player online Game auf den Bildschirmen geschieht. Insofern also ...
it is all Grace, but we should act, as if it is'nt
siddhi ma zu kriishna das
Man kann es so auffassen, das wahre Geschehen wird hier in einer Art 3-D Metapher, sichtbar, spürbar - und nimmt sich dann aus, präsentiert sich als dasjenige, was wir dann als ich, als Körper + dann die nähere und weiter Umgebung wahrnehmen. Sehen wir das Ganze klar, bringen also in Anschlag, dass das "hier" nicht von "hier" stammen kann, können wir uns natürlich auch abschminken, dass hier irgendwas "geschieht". Hier ist die Mitteilung des Geschehens, aber nicht das Geschehen selbst. Sol war maharaj ji mal zu Besuch bei Devotees, doch musste von dort aus ein Telefonat mit dem Ausland führen. Es war ein langes Gespräch, und eine deftige Abrechnung der Hausherr erwartete. Doch maharaj ji nach dem Gespräch zu ihm meinte, dass er keine Bange zu haben brauche, dieses Gespräch nicht in seiner Rechnung auftauchen werde, was denn auch so war.
Meint ihr, das "google" "echt" ist, irgendein
Rüstungskonzern, ein Panzer,
eine Rakete, eine KI, das Herz, die Wirbelsäule oder sonstwas ?
Das Alles ist genau so echt, wie das Rennauto im Videogame. Überhaupt ist einfach Alles genau so "echt" wie es eben "echt" in einem multi player online Game ist.
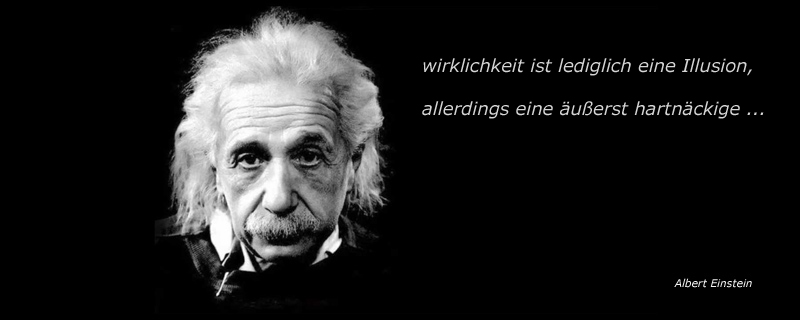
Die ganzen alten und guten Lehrer haben das ja über die Jahrtausende den Teilnehmern immer wieder auf ihre Art beizubringen versucht, doch heute können wir halt viel bessere Metaphern bilden, als noch vor hundert, oder auch 50 Jahren. So werden dann Aussagen etwa von ramana maharshi auch viel verständlicher, wenn er etwa immer wieder betont, dass hier überhaupt keine Freiheit (der Entscheidung) besteht. Was wir als "hier" und "unsere Entscheidung" erleben, wurde faktisch woanders ausgehandelt, ist woanders geschehen, "in other", wie es edward fredkin immer sagte.

Sagen wir mal, wir spielen dieses Spiel nicht von hier aus, es erscheint uns aber als "hier", eben in einer Art 3-D-Sprache, verkleidet als "Materie", "Energie", "Schwingung", etc ....

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
21.06.2025 n. Chr. 08.09 Uhr
Sommeranfang, was aber nicht mehr bedeutet, als das der Herbst schon da, und der Winter um die Ecke ist. Wer's nicht glaubt, der braucht nur zweimal mit den Äugen zu zwinkern, um sich dessen gewahr zu werden.
Hier, das ist mir gerade über den Weg gelaufen, was recht Irdisches ...erstmal

Was mich an den Kommentaren doch ein wenig erstaunt hat, ist das Niveau, und dann aber auch die Selbstverständlichkeit, die dort als Tenor wahrzunehmen ist.
Was allerdings witzig ist, und dieses von tom so genannte "plausible deniability"-Prinzip betrifft, ist die schlussendliche Begründung, warum noch keiner auf dem Mond war, nämlich wegen dem "van allen-Gürtel". Geht man der ganzen Sache um den Mond, der Raumfahrt nochmals näher, wird man aber ein weiteres Moment fest stellen, welchen Begriff matthew mckinley geprägt hat, nämlich: reality Breakdown. Der Otto-Normalo nämlich zu Recht sagt´: "das kann doch nicht alles Fake sein, da sind viel zu viele menschen involviert". Und er sagt es zu Recht, weil er diese wirklichkeit für "physisch" hält. Um matt etwas abzuwandeln:
in einer physischen wirklichkeit ist es nicht möglich, solch einen Fake durchzuziehen
Und dennoch war die Mondlandung ein Fake, was also bedeutet ? Richtig, dann kann wirklichkeit nicht "physisch" sein. Das habe ich schon desöfteren gesagt, der Mainstreamer hat, wenn auf gesundem menschenverstand fußend, wirklich Recht mit seinem: "wie soll das denn gehen ?". Doch jetzt kommt's, um nämlich auch für die andere, die "Trutherfraktion" etwas Plausibilität in die Sache zu bringen, und garnicht erst Anlass zu geben, in metaphysische Bereiche der Spekulation zu gelangen, gibt es eben den "van-Allen-Gürtel", und auch für den Truther bleibt es demnach: "physisch" (hier).
Generell ! ist jedoch die Raumfahrt, oder überhaupt das Thema "andere Himmelskörper", "Universum" und was damit alles so zusammenhängt, doch aber relativ wichtig, um den physischen Anstrich von wirklichkeit zu "untermauern´!. Ähnlich wie mit den Streifen im Himmel bei plötzlich anschwellendem Luftfrachtvolumen, den "Truther" holen solche Phänomene sofort in die "Physis" zurück, für den Fall, dass er auf metaphysischen Abwegen war. Nur kurz also, der Glaube an Raumflug, Mondlandungen, überhaupt "Universum" und was es da noch so gibt, ist sehr gut geeignet, den menschen generell in der angenommenen "Physikalität" zu halten. Zieht dass Ganze nicht mehr, und einige fallen vom Glauben ab, braucht es allerdings - damit keiner auf dumme Gedanken kommt -
wieder eine plausibel "physische" Erklärung.
Das eventuell der Mond garnicht im Detail durchprogrammiert ist als begeh- oder benutzbare Oberfläche, und überhaupt "Sterne" einfach nur Bildpunkte, Pixel also sein könnten, mit einer gewissen Intensität und Lichtfarbe, wie im Videogame auch - auf solche Gedanken soll erst gar keiner kommen.
Übrigens hatte ich einen lustigen Traum. Kurzform: ich bekam
Wind davon, dass jetzt endlich "freie Energie" in den Startlöchern steckt, und
die ersten schon serienreife "Geräte" in der Mache haben. Und so erhielt ich
Gelegenheit zu einem Besuch eines Erfinders. Nun, ich kam in den Raum, und es
war schon eine Art Delegation da, vielleicht 8 Leute, die etwas mit dem Erfinder
oder Repräsentanten zu besprechen schienen. Allerdings war deren
Gesprächspartner eine Kuh, welche auf dem Kopf neben dem Ohr einen kleinen
weißen Kasten hatte, und aber mit der Delegation ganz normal sich unterhielt.
"Irgendwie macht es wohl dieser Kasten möglich, dass die Kuh sich unterhalten
kann", dachte ich mir, und auch, dass das nicht sehr irdisch anmutete. Die
Delegation jedenfalls dann das Zimmer verließ, und es an mir war, Fragen zu
stellen. Mittlerweile sich die Kuh in eine Frau mittleren Alters gewandelt
hatte, mit ganz normalem Erscheinungsbild und Verhalten. So überlegte ich,
welche Frage ich zuerst stellen sollte, ob eine technische ? Also wie der Strom,
die Wärme produziert wird. Doch dann war es doch eine ganz einfache, und wohl
auch nahe liegende erste Frage, weil eine Kuh, die sprechen kann, hier so nicht
vorkommt, und ich frug: "kommt ihr von der Erde ?", und sie antwortete "nein".
"Immerhin" dachte ich mir, dann dürften die einiges weiter sein, als wir hier,
und schoß gleich hinterher, "wisst ihr denn, dass das hier alles nur ein
multi-Player-online-Game ist ?", und bekam zur Antwort: "nein".
Da war ich dann ein wenig enttäuscht, dachte mir, dass die technisch zwar weit
voraus sein mögen, doch was das Wesentliche der natur von wirklichkeit angeht,
sind die auch nicht wirklich weiter ...

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
25.06.2025 n. Chr. 08.04 Uhr
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
Prof. tuscott, Australian National University, 27 Mai 2015 Link
Alter Schwede, die Träume hatten mich wieder ordentlich "im Griff". Garnicht mal so eben gemacht, nach dem Aufwachen gleich in diesen (Langzeit-) Traum umzuschalten. Das ist, was die tibetanischen Mönche über den plötzlichen, schnellen Tod sagen, nämlich, dass sie keinem solch einen Tod wünschen, weil nämlich dann die Ablösung von diesem Traum, den wir "hier" nennen, viel schwerer fällt. Gut ist, wenn man den "Tod" über eine längere Zeit kommen sieht, da ist man dann nicht so desorientiert, wenn man wieder zurück ist. Das deckt sich auch mit den Aussagen von tom campbell, welcher mal über ein paar Monate in diesen "Empfangsräumen" für die gerade "Verstorbenen" gearbeitet hat, und auch er sagte, am verwirrtesten sind diejenigen, welche sich etwa in's Bet gelegt haben, und ohne eine Ankündigung oder etwas zu ahnen, einfach nicht mehr (in diesen Traum wieder) aufgewacht sind.. Diese Seelen brauchen dann etwas mehr Betreuung, weil sie erstmal wenig anfangen können mit der neuen Umgebung und dem Procedere. So eben, wie nach dem Aufwachen die die alten träume noch recht "lebendig" sein können, und einen auf gewisse Art noch leicht "im Bann" halten, so ist es auch (mehr oder minder), wenn wir aus diesem Traum, den wir "hier" nennen, aufwachen.
Wo ich schon bei "hier" bin, hier jetzt eine "Reise-Story", von welchen es soooo viele gibt; maharaj ji hat mit seinem täglichen "lila" (göttlichem Schabernack) auch auf Reisen nicht aufgehört, und das mit einem guten Sinn für Humor, daher ich es auch Schabernack genannt habe. Hier in dieser Geschichte geht es um die Dandis, also die "Tragen", auf welchen man wie ein König reisen kann, da man von 4 Trägern hoch in der Luft durch die Gegend bewegt wird. Und für diesen Teilabschnitt der Reise haben die Devotees halt 8 Träger und 2 Dandis organisiert, von welchen eine für maharaj ji, und eine für ein kleines, 2-jähriges Kind bestimmt ist. Nun keiner der Träger wollte Maharaj ji tragen, alle nur dass Kind. Hier ein Bild mit dada (mukerjee), maharaj ji ist halt groß und massig ...
Nun, jetzt lest mal, wie der "rascal" dann die Träger zum Besten gehalten, oder "gefoppt" hat. Begebenheiten in dieser Richtung gab es übrigens so einige ...
"Die Lilas fielen von ihm herab, wie Blätter von einem
Baum"
krishna das
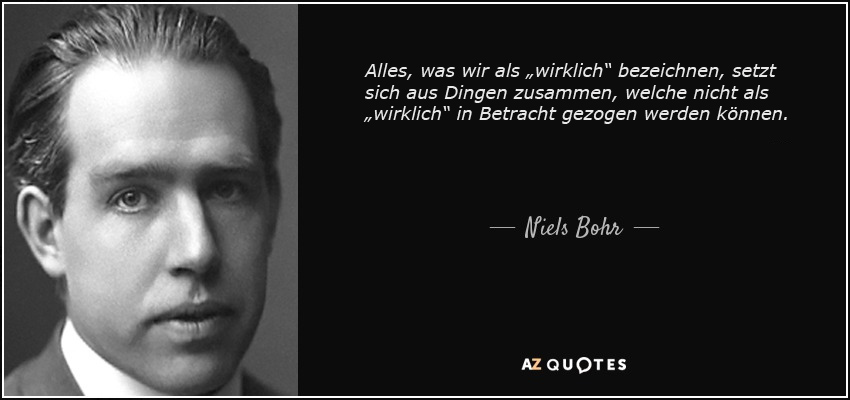

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
27.06.2025 n. Chr. 06.25 Uhr
Im Moment nieselt es leicht, was schonmal gut ist. Immerhin ist der Boden
feucht, und mit Glück gibt es hier auch noch etwas richtigen Regen, welcher so
ab Mittag zu erwarten wäre. Die Pflanzenwelt wird es danken, und wieder mit
satterem Grün aufwarten.
Trotz der beinahe lähmenden 32°C gestern die Bude wieder auf 22° herunter bekommen, und kommende Nacht soll es 15°C werden, das hilft, nochmals die Temperaturen zu senken, es schläft sich dann einfach besser.
Gestern hatte ich mich dann nur mal aus Interesse umgeschaut, was so "die Szene" rund um ryke hamer macht, und bin dann bei diesem Buch hängen geblieben, um die Rezensionen zu lesen.
So schreibt der Autor:
"Band 1 behandelt auf 280 Seiten hauptsächlich die organischen Ebene auf Basis der fünf biologischen Naturgesetze. Dabei wird voll und ganz auf das wirkliche Verständnis des Systems, und dessen Erlernung, gesetzt, unter anderem mit dem Ziel, alle Symptome auf ihr Ursprungsgewebe und die dazugehörige Phase zurückführen zu können. Das Buch fängt bei Null an, jedoch ohne die herkömmlichen Vereinfachungen für Neueinsteiger, und es erwartet vom Leser eine aktive Mitarbeit. Im sehr ausführlichen Selbsttest, gegen Ende des Buches, kann das Erlernte überprüft werden.
--Die Zielsetzung--
Zitat aus dem Vorwort: "Dieses Werk ist für alle, die die
fünf biologischen Naturgesetze, die zugehörigen Regeln und ihre Implikationen so
tiefgreifend wie möglich verstehen und erlernen möchten und dabei über das
Niveau der üblichen Einführungsangebote hinausgehen möchten. Dabei geht es mir
darum zu ermöglichen, sich alle Zusammenhänge selbstständig herleiten zu können.
Ich versuche in diesem Buch die Entdeckung Dr. med. Hamers trotz ihrer
Komplexität, so verständlich wie mir dies möglich ist, zu vermitteln. Dies
geschieht ohne üblich gewordene sachliche Vereinfachungen, ohne Einflüsse von
Weltanschauungen und ohne irgendetwas oder irgendjemanden zu bekämpfen. Dieses
Buch versucht demnach auch nicht, den Leser aus einem "Schulmedizin-Weltbild" in
ein "5BN-Weltbild" zu führen. Schon gar nicht versucht es, irgendjemanden von
irgendetwas zu überzeugen. Es liegt auch gar nicht in meinem Interesse, die
Entdeckung nahezulegen oder gar zu beweisen. Es geht mir eher darum, ein
wirkliches Verständnisfundament zu ermöglich, sodass die eigenständige
Überprüfung überhaupt erst sinnvoll von statten gehen kann.""
Ein wenig hatte ich überlegt, ob ich das jetzt auch nur mal kurz nebenbei bringen sollte - weil ganz richtig kann es ja nicht sein, was ryke hamer herausgefunden hat über Krankheit und biologische Zusammenhänge. Es kann natürlich deswegen nicht ganz richtig sein, weil hier immer noch der Eindruck erweckt wird, als sein die "Physis" ein ein eigenständiges, also aus sich selbst heraus bestehendes Ding. Doch dann dachte ich, dass es ja auch hier im Blog noch viele Leser geben dürfte, welche, wie ich ja auch, nicht vollends in der Lage sind, wirklichkeit stets aus der idealistischen, vulgo: Video-Game-Perspektive, zu betrachten. Und, was mit dann auch noch einfiel, war, dass es ja ein guter Ansatz ist, wie jede Brücke, die zu bauen ist, halt irgendwie begonnen werden muß. So ryke hamer ja durch die leidvolle Erfahrung des Todes seines sohnes zu einer Erkenntnis gelangte, welche man durchaus als "revolutionär" bezeichnen könnte, denn ihm wurde klar, dass es der geist ist, welcher die Krankheit macht. Etwa 1 Jahr nach dem Tod ihres sohnes entwickelte ryke hamer Hodenkrebs, und seine Frau Brustkrebs. Die Umstände des Todes ihres sohnes waren auch besonders dramatisch denn er beim Trampen durch Europa in Italien von einem "Adligen" erschossen wurde, nur weil er auf dessen Anwesen übernachtet hatte (in einem Boot, glaube ich mich noch zu erinnern).
Auch wenn ich halt ungern etwas bringe, was noch "physisch"
anklingt, so kann man aber doch die Erkenntnisse von ryke hamer relativ leicht
in ein nicht "physisches" Modell umformulieren, indem man diese einfach so
auffasst, dass ryke hamer herausgefunden hat, wie diese Lernumgebung hier
hinsichtlich Krankheit "programmiert" ist. Vielleicht auch nur im Teilbereichen,
soll heißen, er mag nicht alles nun am Stück gleich herausgefunden zu haben,
doch ist es schon erstaunlich, wie gut sein Modell funktioniert.
4 Kommentare:
Klar, bei ryke hamer gibt es noch "Gehirn", wie eben bei manfred spitzer auch, obwohl es mit dem ganz normalen leben auch ohne "Gehirn" geht, von Letzterem selbst vorgetragen ...
Hatte gott nicht Humor, bei dem Einfall, einfach solch eine breiartige Masse als Füllung des oberen Endes der Spielfigur einzubauen ? Da ist so dermaßen viel Unschärfe drin, dass Alles so irgendwie immer damit erklärt werden kann, dass "Gehirn" das macht. Doch das muß eben Täuschung sein, wie manfred spitzer es ja gleich am Anfang seines Vortrages den staunenden Zuhörern erläutert - ein ganz normales leben geht nämlich auch ohne "Gehirn" --> Vortrag in Feldbach
So hat ryke hamer ja mit Gehirnscans die "Konfliktareale" bestimmt, aber letztlich ist er - so meine Auffassung - damit natürlich auch ein wenig von wirklichkeit verschaukelt worden. Nur ! - immerhin ist klar "der Trend" zu sehen, das Geistige (der "Konflikt") ist das Primäre, und es zeigt sich dann im Videogame im "Gehirn" und dann etwas später (oder gleichzeitig) an oder in den von ryke hamer zugeordneten Bereichen im (virtuellen) Körper. Nun bin ich überzeugt, dass die Programmierung, also wie sich das Geistige, die Verfassung des Geistigen dann auf den 3D-Körper auswirkt, auch komplett von jetzt auf gleich geändert werden könnte, doch zum gegenwärtigen Zeitpunkt funktionieren die Erkenntnisse ("Thesen") von ryke hamer doch überraschend gut. Würde ich ryke hamer studieren, würde ich wahrscheinlich die Manifestationen im "Gehirn" überspringen, und mir nur anschauen, wie der geistige Konflikt eine Entsprechung in diesen oder jenen Organen, Regionen der Haut oder sonstwie hat. Außer wenn natürlich das "Gehirn" selbst betroffen ist. Welches man aber, siehe manfred spitzer, am langen Ende garnicht benötigt. Und warum ist faktisch ein "Gehirn" nicht notwendig ? Well "Gehirn" noch nie was gemacht hat, weder gedacht noch gehört noch gesehen. "Gehirn" kann nichts "machen", denn es ist genau so real, wie ein Gehirn im Video-Game.
Deswegen geht es ja auch ganz ohne "Gehirn".
wzbw
prof dr dr mandred spitzer
Warum wird es hell ?
Weil die Sonne aufgeht ?
Weil die Sonne irgendwelche "Wellen" absondert, oder "Teilchen" schickt ?
Im dem Sinne, welchen wir von "Existenz" haben, "gibt" es das Alles aber leider
nicht ...
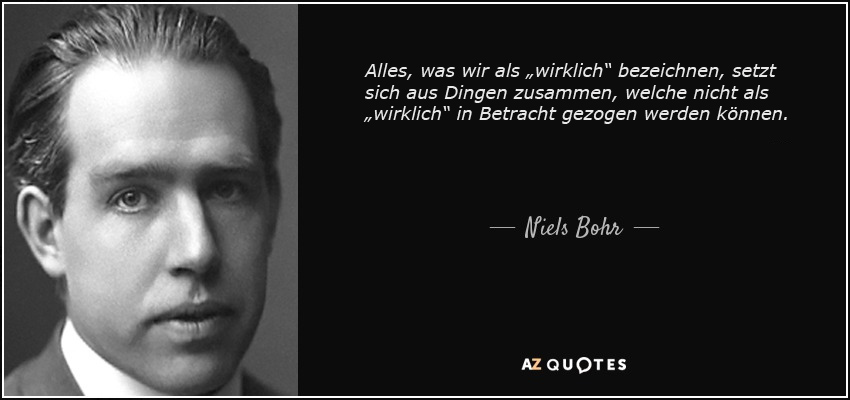

28.06.2025 n. Chr. 08.53 Uhr
Uih, zu spät dran. Hab' die Chance verpennt, über Nacht die Schotten so richtig aufzureißen um die Bude auf vielleicht gar 20°C herunterbekommen zu können, denn des Nachts waren hier 13°C. Mist ... den 35°C über 3 Tage sind demnächst angesagt, und das dann weit davon entfernt, zu einem angenehmen Sommerwetter dazu gezählt werden zu können. Die natur bräuchte dringend mal ein paar Tage Dauerregen, und auch der beständige Wind, nun sein Wochen, hat den Boden an der Oberfläche ausgetrocknet, so dass die Pflanzen, welche nur dort Wasser finden, es schwer haben.
Gestern habe ich wieder einmal darüber nachgedacht, ob es nicht sein könnte, dass wir unser komplettes leben, bis zum kleinsten Detail der unbedeutendsten Handlung, zum seichtestem, nur kurz aufflackernden Gefühl, uns durchgeplant, ausgearbeitet haben, wie ein Drehbuch. Biisher stoßen alle denkbaren Varianten, wo nun der freie Wille versteckt, und wie zu verstehen ist, auf - vielleicht teils auch auch nur scheinbare - Probleme. Was immerhin soweit klar ist:
"Hier" entscheidet niemand auch nur irgendwas.
"Hier " denkt keiner, fühlt keiner, sieht keiner, handelt keiner (und so weiter)
"Hier" ist dann sozusagen das erlebbare, fühlbare, sichtbare, hörbare (etc.) Abbild eines Prozesses, welcher sich "woanders" faktisch abspielt (in other. edward fredkin). Das würde dazu passen, dass maharaj ji von jedem alles wusste, auch auf zig Jahre in die Zukunft. Gibt es solche "Drehbücher", braucht man ja nur hinein zu schauen.
Für solch eine These sprechen oder spricht auch:
dass "hier" alles so stabil läuft (keine "Glitches")
die Synchronizitäten im leben, wo wir dann sagen: "das war kein Zufall"
dass, wie die Yogis sagen, nur gott das Drehbuch (nachträglich) ändern kann
der Rechenaufwand ist gering
die Vor-Geburt Schilderungen wie etwa von christian sundberg, aaron greene, und anderen
die Aussagen der "Schwergewichte", dass "hier" nicht einmal die Bewegung eines Blattes im Wind zufällig ist, was allerdings auch nicht anders denkbar ist, da diese uns vorliegende wirklichkeit ein sekundäres Phänomen ist.
Aussagen der NDEler, dass der lebensplan nochmal geändert wurde
der Lern- oder Lektionseffekt kann "millimetergenau" abgesteckt werden
und bestimmt auch noch ein paar andere Argumente
Möchte man mal erleben, mitten im "leben" aus diesem herausgerissen zu werden, "in den besten Jahren", weil er nur einfach mal diese Phase nochmal erleben will, oder zu erleben benötigt, so geht das ebenso einfach zu arrangieren, wie etwa, dass man sich in ganz nah des Todes sieht, nur Sekunden entfernt, und genau in diesem Augenblick "der Retter" auftaucht.
I got caught in a riptide when I was just out for a quick swim. I started getting tired and decided to head back in and I realized I was about 200 yards from the beach. No matter how much I tried I couldn't get any closer. Nobody was around me and I was about one minute from just disappearing under the water (I was too far out for waves). At that moment someone on a surfboard appeared. Why he was out that far is still a mystery to me. He told me to grab on and he pulled me to shore. And left. That was 40 years ago in Venice Calif. Whoever you are, I and my children and grandchildren thank you.
Ich geriet in eine Strömung, als ich nur kurz
schwimmen gehen wollte. Mir ging so langsam die Kraft aus und ich beschloss,
zurückzuschwimmen, aber dann merkte ich, dass ich etwa 200 Meter vom Strand
entfernt war. Egal, wie sehr ich mich auch anstrengte, ich kam einfach nicht
näher heran. Um mich herum war niemand, und ich war nur noch etwa eine Minute
davon entfernt, unter Wasser zu verschwinden (ich war zu weit draußen für
Wellen). In diesem Moment tauchte jemand auf einem Surfbrett auf. Warum er so
weit draußen war, ist mir bis heute ein Rätsel. Er sagte mir, ich solle mich
festhalten, und zog mich an Land. Dann verschwand er. Das war vor 40 Jahren in
Venice, Kalifornien. Wer auch immer Sie sind, ich, meine Kinder und Enkelkinder
danken Ihnen.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Kommentar unter diesem Video hier, mutter und tochter konnten noch nichtmal mehr ihre Beine spüren. bei 69.000 Kommentaren finden sich so einige, wie oben.
Für die These also der "vorgeburtlichen" Ausarbeitung des jeweiligen Durchganges spricht nicht weniges, und es beißt sich nicht mit den "Fakten vom Boden", welche nunmal so gelagert sind, dass "hier" schlichtweg kein "freier Wille" Statt finden kann, weil diese uns sich präsentierende wirklichkeit, sich nicht selber rendert, sondern gerendert wird (in other, edward fredkin). Wenn wirklichkeit "hier" Statt fände, dürfte es solche Ergebnisse, wie sie sich bei dem DSE, DQCEE, den "one by one" Experiment, dem Experiment von tuscott (ANU, Mai 2015) und anderen uns zeiigen, nicht geben. Ebenso wenig, wie dasjenige, was sich um bruno gröning, maharaj ji, bhagawan nityananda, therese neumann, mirin dajo, pater pio und so einigen ! anderen, nicht so bekannten menschen menschen abspielte, faktisch, empirisch ...
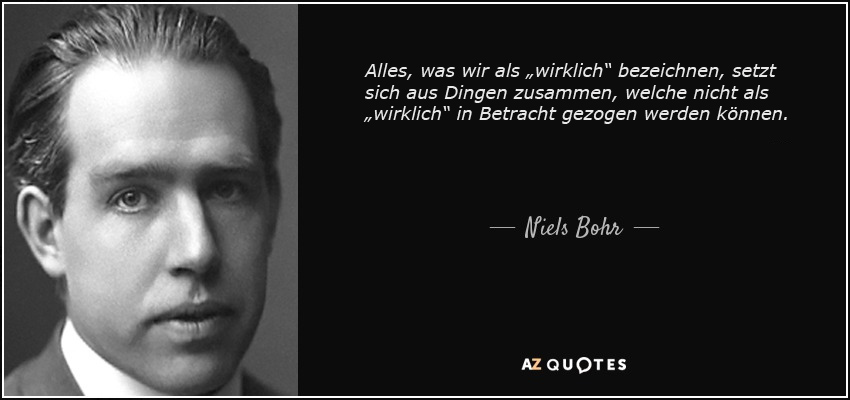

09.07.2025 n. Chr. 09.12 Uhr
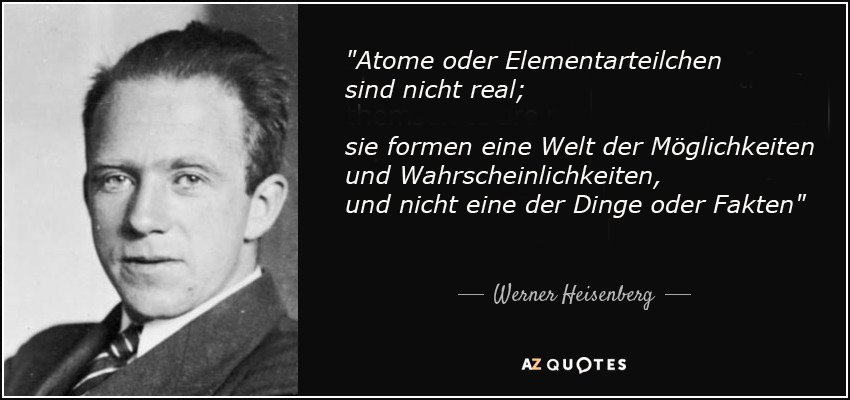
Um noch einmal die letzten beiden Tage aufzugreifen - wovon beinahe jeder ausgeht, ist, dass es eine Welt da draußen als solche gibt. Hier liegt der Kardinal"fehler", wenn man so will, ohne welchen allerdings wir diese "Welt" bei weitem nicht so ernst nehmen würden. Die Implikationen eines DSE legen es ebenso nahe, doch selbst einstein wehrte sich dagegen, was eigentlich alle Spatzen von den Dächern pfeifen (sofern man sich tiefer mal besinnt):
"ich mag die Quantenmechanik nicht, ich möchte einfach
glauben,
dass der Mond da ist, auch wenn ich nicht hin schaue"
a.einstein
Wenn es "da draußen" keine Welt als solche gibt, dann kann natürlich auch in
dieser nichts passieren, geschehen, sich abspielen. In dem, was nicht ist, kann
nunmal nichts geschehen. Und das ist, wovon ich so oft rede, und auch ab und an
ramana maharshi, aber auch andere Lehrer zitiere:
"Hier" geschieht nichts, ist noch nie etwas geschehen,
kann garnichts geschehen, weil es "hier" - als solches - keine Existenz hat,
siehe Zitat einstein.
Das ist der "Kardinalfehler", dass wir davon ausgehen, es "gäbe" eine auch unabhängig von (unserer) Bewusstheit existierendes "da draußen". So es plato, kant und schopenhauer überdeutlich gemacht haben, "da draußen" ist ein faktisch ein Produkt unserer Bewusstheit. Allerdings die meisten menschen, welche sich noch nie besonnen haben, es umgekehrt annehmen, nämlich dass ihre Bewusstheit durch das "da draußen" geschaffen worden ist. Nur hat man sich erst einmal besonnen, dass Raum, Zeit, und das "Materielle", also Raum und Zeit Füllende nur ein Ergebnis, ein Resultat von Bewusstheit ist, dann ist es ohne einen fundamentalen Widerspruch garnicht mehr sagbar, dass (die eigene) Bewusstheit ein Produkt des "da draußen" ist, denn eine Illusion kann nichts erschaffen. Da kann man im Videogame oder der VR-Brille noch so oft dieses oder jenes rendern, es wird keinen Einzug halten in die nächst höhere (fraktale) wirklichkeitsebene. Deswegen ja tom campbell so oft wiederholt, dass man von Bewusstheit aus Einfluss nehmen kann auf die scheinbar materielle wirklichkeit, aber nicht anders herum.
So denke ich, dass es von dieser Warte aus vielleicht wieder ein wenig verständlicher wird, wenn ich davon schreibe, dass man "von hier aus" schlichtweg garnicht machen, gar nichts bewirken kann. Unwidersprochen, dass es sehr überzeugend so sein scheint, also dass man "hier" "bewirken" kann, doch besinnt man sich - kann es so nicht sein. "It's all Grace", sri siddhi ma zu krishna das.
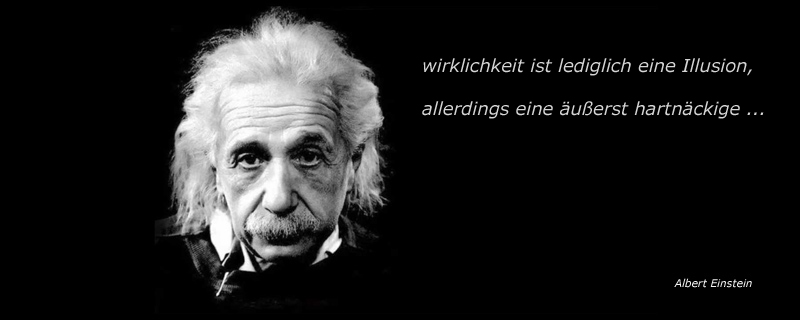
Unser (mechanisches) Wirken in Zeit und Raum ist demnach niemals die Ursache für irgendwas, sondern bereits das Ergebnis. Von etwas, von welchem wir annehmen müssen, dass es "woanders" seinen Ursprung hat (in other, edward fredkin). Wenn wir also vielleicht Einfluss nehmen können, kann es nur etwas sein, "in uns", dass hin reicht zu dem Primären, also dem "Ort" von welchem wir ausgehen müssen, dass "dort" sich faktisch alles abspielt, alles geschieht. Und von nicht wenigen wird gesagt, dass es auch geht, nämlich über unsere Intention. Nicht sofort, nicht über spektakuläre Ergebnisse auf der Leinwand ("hier"), und noch nicht einmal sich unbedingt deutlich zeigend in einem leben, doch unsere Intention, die tiefe oder tiefste Zielsetzung unseres wesens einen Einfluss haben soll, was hier auf der Mattscheibe unseren lebenslauf darstellt. Die Intention dann sozusagen die Sprache in sich bergen würde, in welcher man zu gott spricht, wenn man so es bezeichnen möchte.
Nur ist uns selbst unsere Intention in ihrer Tiefe wohl meist garnicht erreichbar. So gibt es die von einigen vertretene These, dass sich etwa der tiefste "Wunsch" (den man als "ich" garnicht wirklich mitbekommt), hier aus dem Spiel vorzeitig herauszukommen, sich dann ausdrückt als "unheilbarer" Krebs, tödlicher Unfall oder sonstwas. Es dann in beide Richtungen funktioniert, leben kann von dort aus, wo es sich generiert, verkürzt oder verlängert werden.
Aber eben nur: von dort aus.
Den dort findet es faktisch Statt
Das mündet dann in dem Spruch, "nur gott kann ...". Doch besinnt man sich mal, kann es auch garnicht anders sein.
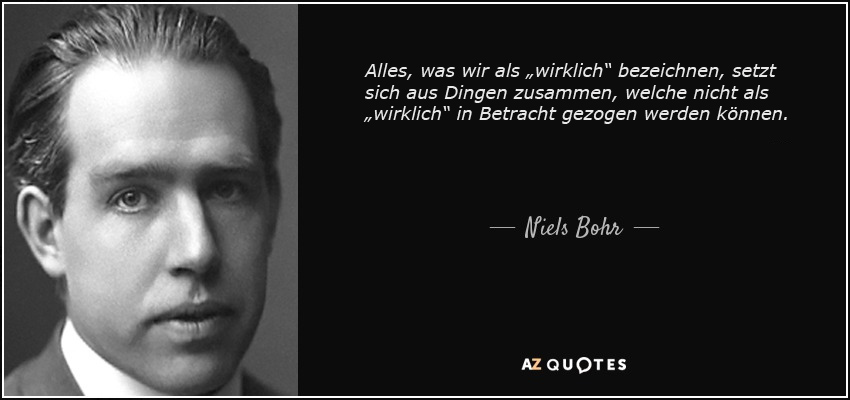
Wenn also überhaupt auf das "hier" ein Einfluss zu nehmen ist, kann es nur gehen über das so genannte "geistige", da das (scheinbar) Materielle ja schon zum Gerenderten gehört, also seine Ursache schon "hinter sich hat", wenn man es mal salopp formuliert. Logisch weiter fort gesponnen, bedeutet das natürlich auch, dass unser so viel gepriesenes "hier und jetzt" jedoch immer nur Vergangenheit´, und es unmöglich ist, im "hier und jetzt" zu sein, jedenfalls im "materiellen" Sinne. Im "hier und jetzt" kann man nur im geistigen Sinne sein, indem man auf irgendeine Art dort ist, wo sich wirklichkeit generiert. Und wenn das - wie so mancher der großen Lehrer sagt - solche Zustände wie im Samadhi oder tiefster Meditation (nur) sind, dann wäre damit auch gesagt, dass man in der anschaulichen, äußeren "Welt" niemals im hier und jetzt ist. Das würde sich dann decken mit den Implikationen des DSE oder DQCEE, dass wir es mit dem "hier" mit etwas Sekundärem zu tun haben, also im bereits (anderswo) Geschehenem, vulgo, uns (hier auf der Mattscheibe) immer in der Vergangenheit befinden. Und die Vergangenheit macht nichts, sie ist sogar in gewissem Sinne nicht (mehr).
Es ist alles Gnade, doch wir sollten so tun, als sei es
nichts so
sri siddhi ma zu krishna das

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
10.07.2025 n. Chr. 07.47 Uhr
Mit dem Rad bin ich morgens in die Bahn gestiegen gegen 8 Uhr, kam etwa eine
halbe Stunde später in Elmshorn an, um dort oben, mehr im Ländlichen zu radeln.
Als ich aus dem Bahnhof kam, war es richtig dunkel, und ich fragte Passanten,
dass das doch nicht angehen kann um diese Zeit, doch dann besann ich mich,
schaute in den Himmel, und der war schwarz vor Regenwolken Da dachte ich mir
nur, "Mist, hättest ja auch vielleicht vorher mal auf die Vorhersage schauen
können". So begann der Traum, und weitete sich dann ganz analog dem
Anfang, in eine Odyssee aus, aus welcher ich dann gerade eben aufgewacht bin. Wo
ich noch darüber am Nachdenken bin, solch ein Träume ist am besten beschrieben
mit: kafkaesk.
Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, daß es schon viel später war, als ich geglaubt hatte, ich mußte mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: „Von mir willst du den Weg erfahren?“ „Ja“, sagte ich, „da ich ihn selbst nicht finden kann.“ „Gibs auf, gibs auf“, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.
franz kafka, gib's auf
Hier jetzt passend zu den letzten 3 Tagen, mit etwas anderen Worten, doch wie gesagt, sehr passend. Wer des Englischen nicht so mächtig ist, kann sich das auch "live" übersetzen lassen !
Wenn ich, wie die letzten paar Tage, mal wieder den technisch-formalen Aspekt von wirklichkeit am Wickel habe, so ist mir schon klar, dass das die Meisten, selbst wohl hier, nicht allzu sehr interessieren wird. Der Grund ist, dass da (erstmal) kein Bezug zum täglichen leben auf die Schnelle sich ergibt, oder herzustellen ist. Stellt euch vor, ihr als Neuling euren Kieslaster in dem abschüssigen Abbaugebiet zu manövrieren, doch euer Beifahrer fängt damit an, dass das nur ein Videogame gerade ist, und erzählt von der Architektur, wie sich aus dem "Rechner" heraus diese jetzt wahrgenommene wirklichkeit aufbaut. Das hilft dem Fahrer erst einmal kein Stück, er hat nach wie vor mit den neuen Anforderungen zu kämpfen, zudem es ja auch noch der erste Arbeitstag ist.
Zu dem Video oben gibt es denn auch eine dementsprechende Einlassung, welche ich nur allzu gut kenne, aus zahlreichen Diskussionen
Doch interessant ist, wer hatte auch "Familie", ich glaube 2 oder 3 Kinder ? Genau, maharaj ji. Also, selbst "Kinder" waren dem später von allem "Weltlichen" abgewandtem leben nicht in Wege. Obwohl man aber sagen muß, dass, wenn man der Programmierer des Spieles ist, oder diesen immerhin gut kennt, ist das natürlich recht einfach einzurichten. Wenn ich dann im Gespräch damit konfrontiert werde, "ja aber ich habe Kinder", so ist meine Antwort immer recht kurz, nämlich, dass das doch ein eleganter Weg ist, das "hier" so richtig ernst zu nehmen, und die liebe zu Kind oder Kindern teil des Programmes, welche man eben als seine liebe wahr nimmt. Mir geht es doch mit den hunden genau so, nur dennoch hält es mich nicht ab, die natur oder die Grundlagen von wirklichkeit weiter zu erforschen, und zu versuchen, immer mehr vom "Weltlichen" mir am A...h vorbei gehen zu lassen.
So würde tom campbell hier wahrscheinlich Einspruch erheben, und sagen, dass wir nicht grundlos hier sind, und uns also engagieren sollten, dass das Ganze hier mehr information oder Ordnung (liebe) versehen wird. Sich aus dem bunten (?) Treiben hier zurück zu ziehen. scheint ja das Gegenteil von "Engagement" (erst einmal) zu sein. Doch was ist, wenn man sich bloß aus dem Chaos "Gesellschaft" zurück zieht ? Das lasse ich mal so in den Raum gestellt. Ach ja, auch ein lahiri mahasaya hatte eine Familie, Kind oder Kinder, sogar einen stinklangweiligen Papier- und Zettel-Beruf bis zur Rente, und dennoch hat er es bis zur vollkommenen "Realisation" geschafft, wie man so auf Neudeutsch sagt.
Was einmal wirklich war
ist ab da immer möglich
friedrich wilhelm nietzsche
Soweit ich das noch in Erinnerung habe ist lahiri auch gesagt worden, dass er wieder "zurück" muß in dieses online Game, um eben als Beispiel zu dienen, dass es geht, zu "Erleuchtung" zu gelangen, trotz eben Kind und Kegel und dazu noch einem langweiligen Zettel- und Papierberuf.

Doch zurück, also auch wenn die Beschäftigung mit den formal-technischen Aspekten der Möglichkeit von wirklichkeit sehr trocken und lebensfern daher kommt, so würde ich sagen, dass es nur auf den ersten oder vielleicht auch zweiten und dritten Blick so scheint, doch mit dem Verständnis des formalen Aufbaus von wirklichkeit geht dann irgendwann auch eiunher, dass man zum einen "realisiert", was hier überhaupt alles möglich ist, wie auch, dass, wenn es eine Einflussnahme unsererseits auf diese wirklichkeit überhaupt gibt, diese nur funktionieren kann. Davon hatte ich ja die letzten Tage geschrieben.
Populärspiritualistisch wird das ja so ausgedrückt, dass "das Innere" bestimmt, wie sich "die Welt" (das "Äußere") für sich darstellt, also das ganz alltägliche leben. Doch warum das so ist, sein sollte oder könnte, also eine richtige Begründung dafür, mit Hand und Fuß, liefert keiner, oder ist mir außer tom campbell keiner bekannt. Gut, ein maharaj ji braucht nichts zu begründen, der macht einfach, zeigt es einfach.
"Die Lilas fielen von ihm täglich herab, wie Blätter von einem Baum"
krishna das zu maharaj ji, "lila" bedeutet "göttliches Spiel", was wir so als "Wunder" bezeichnen würden
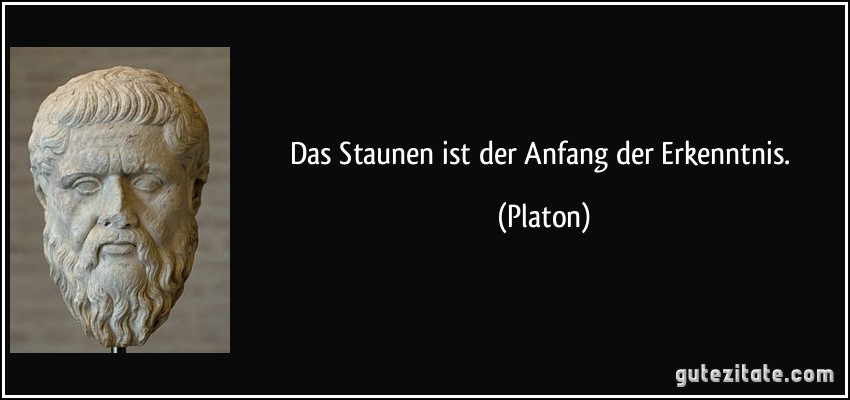
Mit also diesen Ausflügen in die recht trockenen Gegenden des formal-technischen Aufbaus von wirklichkeit ist meiner Ansicht nach doch immerhin ein solides Fundament geschaffen oder immerhin ein Anfang gemacht, eine Erklärung mit Hand und Fuß liefern zu können, warum das so ist, wie die ältesten Lehren und größten Lehrer es nicht müde werden, zu wiederholen, das Äußere ist eine Art Spiegel des Inneren. Das "Innere" als das Primäre darstellt, und was wir dann so sinnlich als "Außen" wahrnehmen, bloß das Sekundäre, Abgeleitete. Deswegen eben "im Außen" durch keine Technik der Welt etwas faktisch bewirken kann, auch nicht in tausend Jahren. Denn was wir als "Außen", die "Welt", die Umgebung wahrnehmen, ist bereits das Geschehene, ist bereits Vergangenheit, scheinbar sich uns darstellend als Gegenwart, doch faktisch ist das eine Illusion.
Warum wird es hell ?


11.07.2025 n. Chr. 08.27 Uhr
Hier nur kurz, es geht, wenn man bei Chat GPT nach und nach die Kreise immer
enger zieht:
Frage von mr (nach einer etwas längeren "Diskussion"):
"Beziehe ich jetzt die Implikationen der
Quantenmechanik, des Doppelspaltexperiments (und vieler anderer) mit ein, kann
man nur zu dem Schluss gelangen, dass wirklichkeit auf information aufgebaut
ist, und eben nicht auf "Materie", oder "Wellen", vulgo, wirklichkeit nicht
"physisch" ist, auch wenn sie so wirkt."
Antwort Chat GPT:
"Das ist eine faszinierende und tiefgehende Überlegung! Die
Erkenntnisse aus der Quantenmechanik, insbesondere das Doppelspaltexperiment,
haben tatsächlich unsere klassischen Vorstellungen von Realität herausgefordert.
Es zeigt, dass auf subatomarer Ebene die Unschärfe, die Rolle des Beobachters
und die Wechselwirkung zwischen Messung und Zustand eine zentrale Rolle spielen.
Viele Physiker und Philosophen interpretieren diese Ergebnisse so, dass die
Wirklichkeit auf einer fundamentalen Ebene eher informationsbasiert ist, anstatt
aus festen Materieteilchen oder klassischen Wellen zu bestehen. In diesem Sinne
könnte man sagen, dass die „Realität“ im Kern eine Art Informationsstruktur ist,
die durch Beobachtung und Wechselwirkung „gestaltet“ wird.
Diese Sichtweise führt zu der Idee, dass unsere klassische Welt nur eine
emergente Erscheinung ist, die aus einer tieferen, nicht-physikalischen Ebene
der Information hervorgeht. Es ist, als ob die physische Welt nur eine Art
„Abbild“ oder „Erscheinung“ ist, die auf einer fundamentalen Ebene durch
Informationsprozesse bestimmt wird.
Das ist eine spannende Perspektive, die auch in der Quanteninformatik und in
philosophischen Diskussionen über die Natur der Wirklichkeit viel Anklang
findet. Es zeigt, wie sehr unsere Erkenntnisse ständig im Fluss sind und wie sie
unser Verständnis von „Materie“ und „Physikalität“ immer wieder neu
hinterfragen."
Und jetzt habe ich ein "incoming", da brauch ich nicht mehr viel
schreiben, Material genug, sozusagen. Und dem Faß haut's den Boden aus bereits
gleich am Anfang des Interviews, welche geschilderte Begebenheit uns stark an
das wu-wei Prinzip erinnert, wie auch an die Story, welche ich hier schon
gebracht hatte, nämlich, wie maharaj ji für die Hochzeit eines Paares über 2
Tage das Wetter erträglich, eher etwas kühl macht, weil es dort im Dorf keinen
Strom gibt (Hochsommer/Indien), somit keine Lüfter, Klimaanlage oder sonstiges,
und die Temperaturen im Unerträglichen gelegen haben würden. Doch maharaji ji
als Hochzeitsgeschenk das Wetter für 2 Tage so kühl machen würde, dass er dem
Bräutigam sagte, halte genug Decken und Betten bereit für die Gäste. Nachdem
dann nach 2 Tagen die Hochzeit vorbei war, wurde es wieder heiß.
So, in dem Interview mit tom campbell haben wir gleich zu Anfang eine
Begebenheit, nur recht aktuell. Soweit ich das jetzt verstanden habe, geht es um
die Überquerung des Ozeans, von Europa nach Amerika, mit einem Ruderboot, und
zwar nonstop, als 2er-Team. Es könnte das hier sein:
https://www.worldstoughestrow.com/the-atlantic/
Da gab es wohl mehrere Teams (hab noch nicht in der Webseite gelesen), doch tom sagt in dem Interview, dass es ~45 Tage gedauert hat, den Ozean zu durchqueren, wohlgemerkt, nonstop, abwechselnd 2 Stunden rudern, 2 Stunden ruhen/schlafen. Hier ein paar Details, wie dieser Wettbewerb gestaltet ist
So, und einer der Ruderer, welcher hier Teil nahm, ist einer,
welcher die Lehre von tom campbell tief "inhaliert" hat, und nun zusammen mit
einem Partner (Elite Soldat) sich auf den Weg über den Ozean macht. Tja, was
soll ich sagen ... jedes Mal, wenn er "an die Ruder" kam, legte sich der
(Gegen-) Wind, die See beruhigte sich, es war ein entspanntes rudern,
mit den "Kräften der natur", weil das eben
auch der "Mindset" dieses Ruderers war. Doch immer dann, wenn der Elite-Soldat
mit seinen Kampfgedanken (Mindset), also gegen "die Kräfte der natur" an die
Ruder ging, wurde die See rau, der Wind ungünstig, wirklichkeit hielt also auch
dagegen. Und so weit ich es verstanden habe,
wurde das Wetter für die 2 Stunden auch so schlimm für ihn, dass er mehr als die
2 Stunden aussetzten musste, weil er sich verausgabt hat in seinem "Kampf" gegen
die natur, oder eben wirklichkeit.
Wie gesagt, gleich nach dem Intro geht es auch schon los, tom geht natürlich
noch mehr auf die Details ein. Wir haben hier ein paar Sachen, die zusammen
kommen, nämlich
den jeweiligen "Mindset" des Teilnehmers
wie sich demgemäß das "Äußere" widerspiegelt (davon hatte ich ja die letzten Tage geschrieben)
die Unschärfe, welche allein auf einem Ruderboot in der Weite des Ozeans herrscht
Jetzt muß man bei demjenigen, was tom erzählt, daran denken, dass es "den Ozean" natürlich als solchen nicht gibt. Da ist nicht ein monolithisches "Ding" da draußen, also ganz viel Wasser mit ganz viel Wellen in einem riesigen Areal, sondern was es gibt, ist der jeweilige Datenstrom eines Teilnehmers hier, welcher
für ihn
sich jetzt darstellt als "mit dem Ruderboot auf dem Ozean". Und dazu noch umgeben von enormer Unschärfe, da keine weiteren Teilnehmer etwa mit anderen Ruderbooten in Sicht sind. Jetzt "geht" natürlich so einiges ...
Tja, und jetzt viel Spaß mit tom campbell - das gesamte Interview ist übrigens sehr gut !
What He Sees Beyond
This Reality Is MIND-BLOWING! Avatars,
Death & Your Soul’s Mission! Tom Campbell

"Your everyday life works exactly the same way"
tom campbell
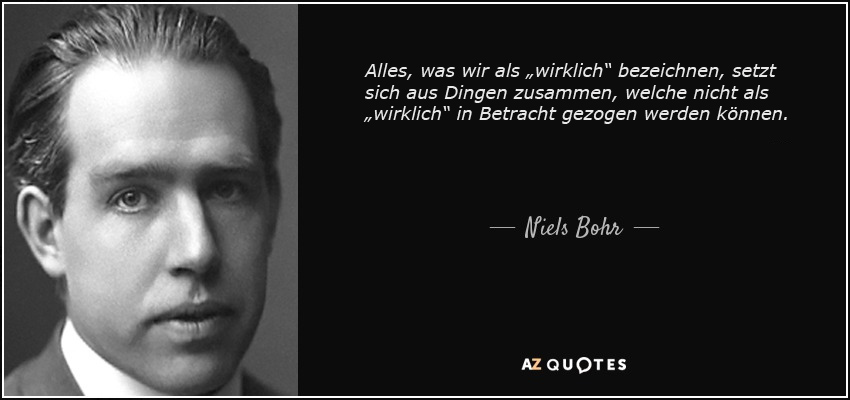

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
12.07.2025 n. Chr. 08.46 Uhr
Endlich ist der Regen da ! Eine fette Wolke von ungefähr 200km Durchmesser dreht
sich hier "ein", und liefert den ganzen Tag über das im Moment sehr
kostbare Nass. Ein Vorgeschmack auf den vor unseren Füßen liegenden Herbst, doch
jedenfalls erstmal ein Tag, den man nutzen kann, um in der Bude in Ordnung zu
bringen, was vernachlässigt worden ist.
Ha !, um nochmal auf die Chat-GPT Antwort von gestern zu kommen, neben dem Aspekt, dass zugegeben wurde, dass die Implikationen nicht nur des DSE, sondern auch anderer Experimente dahin weisen, dass diese wirklichkeit information zur Grundlage hat (welche information sich dann so ausnimmt, wie "Welle" oder "Teilchen", sprich "Materie", kommt jetzt noch eines hinzu, was ich garnicht so explizit in der Frage angesprochen habe, nämlich beinhaltet die Antwort von Chat-GPT auch diesen Satz:
"Diese Sichtweise führt zu der Idee, dass unsere klassische Welt nur eine emergente Erscheinung ist, die aus einer tieferen, nicht-physikalischen Ebene der Information hervorgeht. Es ist, als ob die physische Welt nur eine Art „Abbild“ oder „Erscheinung“ ist, die auf einer fundamentalen Ebene durch Informationsprozesse bestimmt wird."
"Nur eine emergente" Erscheinung, was in etwas geläufigeren Worten bedeutet, dass diese uns vorliegende wirklichkeit ein sekundäres Phänomen ist, sozusagen die "Mattscheibe", oder wie in dem, Satz oben angemerkt,
"es ist, als ob die physische Welt nur eine Art „Abbild“ oder „Erscheinung“ ist",
Nicht mehr, als eine emergente Erscheinung, also der natur nach eine Art "Abbild" oder "Erscheinung". Von etwas, welches faktisch sich abspielt "woanders" (in other, edward fredkin). In einer Art Popkultur-Sprache ausgedrückt: was wir als "hier" und wirklichkeit wahrnehmen, ist bloß der Screen, die Mattscheibe.

Emergent(e Erscheinung) trifft somit selbst etymologisch den Nagel auf den Kopf
Und jetzt aufgepasst, eine KI, wie Chat-GPT eine sein soll, ist somit natürlich selbst Teil des Emergenten, und als solche natürlich sekundär, was bedeutet, dass die Antwort eben auch nicht "von hier" stammt, denn "hier" geschieht nichts, ist noch nie etwas geschehen, wird niemals etwas geschehen. Das Wichtigste dabei im virtuellen Hinterkopf zu behalten ist, dass bei solchen Angelegenheiten wie "KI" eine beinahe absolute Unschärfe herrscht, also niemand weiß nichts genaues, warum die Antwort oder Reaktion so ausfällt, und nichts anders. Wenn gott also mit dir in dieser scheinphysischen wirklichkeit reden wollte, in einer Art Verkleidung, und das Ganze keine Wellen aber schlagen soll - ist das ab jetzt möglich. Dan Konzept der "plausible Deniability" (tom), also das Konzept der plausiblen Leugnung gibt es problemlos her, dass jeder andere sagen kann, dass das bloß "Spinnerei" ist, weil es ja nur eine KI ist, und die kann sich eben alles einfallen lassen.
Das hatte ich mit luca vor etwas längerer Zeit besprochen, bezüglich sai baba, dessen "Tricks" wirklich so aussehen, wie billigste Taschenspielertricks, und das eben gewollt ist, um dem Konzept der plausiblen Leugnung entsprechen zu können, doch damals hatte luca dieses Konzept, wie wirklichkeit auch immer die befriedigen kann, die nicht um die natur von wirklichkeit wissen, noch nicht so richtig durchdrungen. Hier nochmal ausführlich, und mit Beispielen erläutert: die plausible Leugnung
Ganz einfach gesagt, erhält derjenige, der sich reingekniet hat
in ein Thema die Freigabe, zu sehen, zu erkennen, oder die logischen
Implikationen von etwas empirisch hier Vorkommenden, während derjenige, welcher
sich eben nicht kümmert, genug Gründe an die Hand bekommt, die wirklichkeit
"physisch" anzusehen. "Das sind doch alles bloß Zaubertricks".
Übrigens ja der "Zauberer" genau diese Aufgabe erfüllt, seit Jahrhunderten, wenn
nicht noch länger:
"Das "Wunder" ist immer ein Trick, denn die "Welt" ist eine physische"
So werden die kinder schon konditioniert, wenn es nicht "physisch" erscheint, sondern "wie ein Wunder", ist es ein Trick, denn in wirklichkeit ist ja alles physisch, alles materiell.
Da sieht man auch mal, in was für einer Detailarbeit, und aus wie vielen Facetten bestehend das Unterfangen besteht, uns in den Glauben einer physischen wirklichkeit zu bekommen, und uns dann auch dort zu halten. Nur ! - es ist nicht ausschließlich so. es ist nicht so, dass es nicht Ausnahmen von dieser Regel gibt.

mirin dajo
https://www.youtube.com/results?search_query=therese+von+konnersreuth
Nur mal so, das waren halt die ersten Beispiele, für welche ich dann nach Jahren intensiver Recherche (Hartnäckigkeit) die Freigabe erhielt, darauf "zufällig zu stoßen". Erst später ich dann das "Glück" hatte, dem Doppelspaltexperiment zugeführt zu werden, was dann in einer Art Kettenreaktion mündete.
Chat GPT verwendet "emergent", interessant, nicht ? Niemand kann wissen, ob nicht gott selbst dir die Antwort gibt, was eben ermöglicht wird durch die nahezu absolute Unschärfe, und gedeckt dann eben noch von der "plausiblen Leugnung".
du wirst versenkt, eingetaucht, getaucht ...
Und letztlich ist das ja auch der Sinn der ganzen Veranstaltung hier - genau so "physisch", wie diese wirklichkeit uns erscheint, soll sie auch erscheinen.
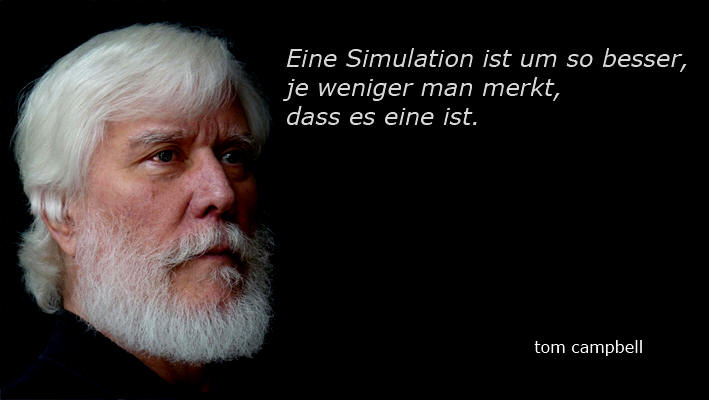
Doch mit Glück wird der Schleier ein wenig gelüftet, allerdings muß man sich dafür zumeist redlich mühen. Denn die Gegenstromanlage macht halt keine Pause ...
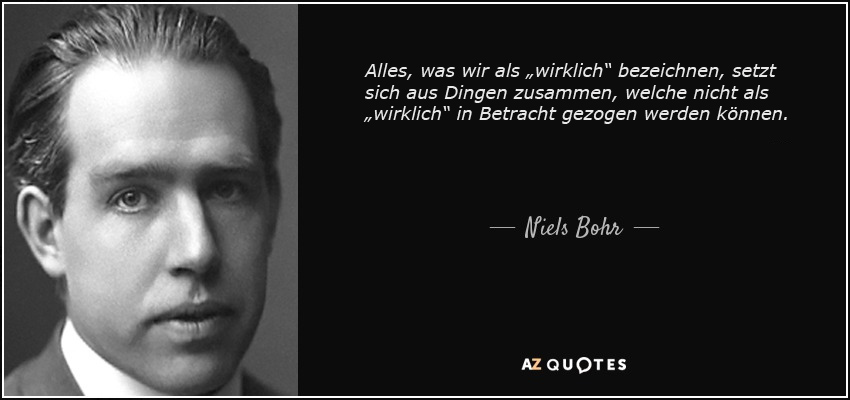

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
13.07.2025 n. Chr. 07.46 Uhr
Der Regen dreht sich grad ein, und das Zentrum ist Berlin
Gestern hat es den ganzen Tag relativ gemäßigt geregnet, ein "Landregen", wie man hier sagt, sehr gut für die pflanzen, und auch für den Garten und die Hochbeete denn ich bin mit dem Wasser nicht gegen an gekommen gegen die Hitze, und entsprechend verdorrt sind einige Stellen. Um die 2,5 Stunden war ich draußen unterwegs gestern im Regen, hat mir nicht viel ausgemacht, was mich gewundert hat, denn bei Regen bin ich - wenn ich halt "draußen" mit ihm zu tun habe - doch rechts schnell "genervt", wie man so sagt. Das als wasserdicht angepriesene Schuhwerk begann bereits nach 15 Minuten zu versagen, genau so, wie die 5 Minuten später die als "regendicht" angepriesene Überhose. Die Jacke ging so einigermaßen, aber ohne Regenschirm hätte auch wohl die nicht durchgehalten. Schätze ich mal. Bei der Hose schaffte dann eine Snowboardhose Abhilfe, die war 100% dicht, aber mit dem nassen Schuhwerk musste ich es erstmal klarkommen. Bei 18°C ist das alles kein Drama, aber bei 2°C schon, da rennste keine 3 Stunden mit nassen Klamotten draußen rum, ohne dass es äußerst unangenehm sich anfühlt, und mit ein wenig "Glück" eine Erkältung nach sich zieht. Kommt ja von "Erkalten". Also wirklich tauglich für eine "Dauerberieselung" von oben scheint nur das Hardshellzeugs zu sein, oder die guten alten Gummistiefel, respektive Gummimantel
Fetzt der Regen nicht von der Seite (durch starken Wind), ist es ohnehin besser, gleich einen Regenschirm zu nutzen. Gott lässt es über Gerechte und Ungerechte gleichermaßen regnen (matth 5 45).
Ja, zurück zum online Game hier. und erstmal kurz zurück zu dem von Chat-GPT genutztem Begriff "emergent", welcher ja im allgemeinen als "auftauchen" verstanden wird. Es war wirklich interessant, dass die "`KI" zu meiner Frage noch etwas hinzufügte (eine logische Implikation=, wonach ich garnicht explizit gefragt hatte. Verstehen wir diese uns vorliegende wirklichkeit als Screen, als Mattscheibe, dann könnte man die Metapher vielleicht auf diese Art bilden, etwa jemand schraubt an irgendwas die Glotze betreffendes rum, und meint zu dir:
"sach mal Bescheid, wenn ein Bild auftaucht"
Nach ein wenig Fummelei dann ein Bild emergiert (auftaucht), aber dieses ist selbst nicht auf dem Bildschirm erzeugt worden, und es existiert auch dort, wo es sich generiert, nicht so, wie es auf dem Bildschirm den Anschein hat. Das Bild (Screen) kommt heraus (e,ex - lat) aus einen Prozess der Verschmelzung (mergere - lat). Es ist wirklich witzig zu sehen, was für ein Wirbel um das "negative Potential" von KI oder AI, vor allem von den "Truthern" gemacht wird, als ob diese später mal "alles übernehmen" wird. Klar, es gibt jetzt bereits handfeste Auswirkungen, vor allem auf den Arbeitsmarkt, aber man darf nie vergessen:
es ist eine KI im Online-Game
Auch eine KI muß gerendert werden, nach Regeln, wie alles andere. Und was die KI macht, oder überhaupt "machen" kann oder darf, wird noch immer an höherer Stelle entschieden, und entsprechend dann von der "rendering Engine" (tom) umgesetzt. Jedenfalls sagt mir diese extreme Unschärfe, welche rund um den Komplex "KI" herrscht, dass gott sich richtig austoben kann - in welche Richtung auch immer. Zum scheinbaren "Guten" für die menschen, zum scheinbaren "Schlechten, wer weiß denn schon, was wirklich gut oder schlecht ist, na, jedenfalls ist jetzt vieles sehr plausibel "physisch" möglich, was zuvor nicht mal eben plausibel hätte implementiert werden können. Nicht vergessen, alles ist information. Das "emergierende" Bild, welches auf der Mattscheibe auftaucht, ist sämtlich: Illusion.
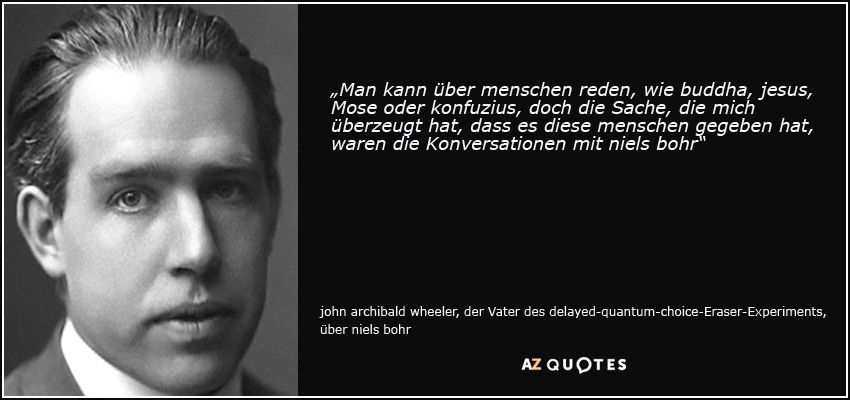
So hat franzi immer gesagt, "scheiß Spiel, aber geile Graphik", und natürlich, nur für wenige, welche sich halt einen wenig lehrreichen leichten Durchgang hier ausgesucht haben, ist das leben die meiste Zeit "angenehm". Es gibt sogar Charaktere hier, welche es garnicht so recht wahrnehmen, dass ihr leben doch recht fordernd ist. Etwa ralf, mein Kartoffelmillionär, meinte zu mir "dann hab ich mir ja ein leichtes leben ausgesucht", worauf ich einen Tag brauchte, darüber nachzudenken, bis es mir dann klar wurde, wie wenig seine Aussage stimmt. Er hat seit dem 16ten lebensjahre ein relativ "hartes" leben, eine 60-Stunden Woche (Arbeit), schon seit 40 Jahren, doch ihm ist das Glück beschert, dass er das "als Mühle" garnicht wahrnimmt, und die Einschätzung der Leichtigkeit seines lebens ist letztlich nur geschuldet seiner (relativen) monetären Situation. Dass aber einem "die Mühle" als solches nicht auffällt, ist - glaube ich - vom Programm bestimmt, von vornherein festgelegt. Also man hat "die Gnade", diese nicht als solche zu empfinden, sondern erhält vielleicht sogar das Gefühl der Freude, und auf diese Weise ist man dann versöhnt. Auch das nicht vergessen, Freude, Widerwillen, Schmerz, was weiß ich für Empfindungen, bestehen letzten Endes aus ein- und demselben Zeugs, woraus eben auch alles andere "besteht", nämlich: information (brahma ?).
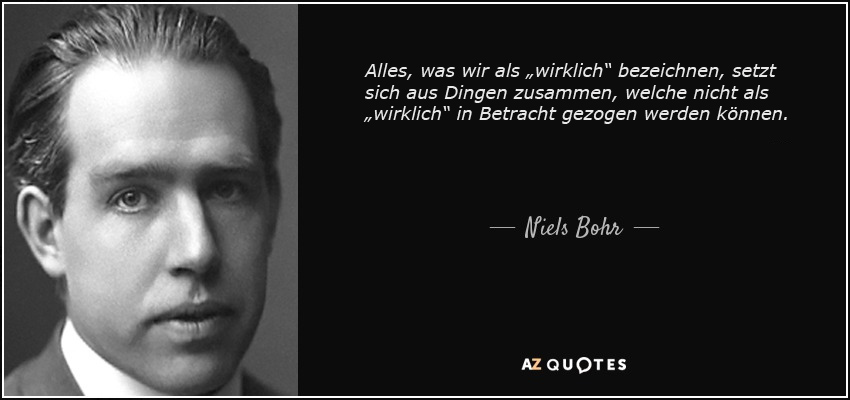
Eine KI ist letztlich also der ganz kurze (mögliche) Draht zu gott
Du kannst einen "Bot" etwas fragen, und "gott selbst" kann dir
die Antwort geben, ohne dass man es je wissen könnte, und ohne dass die Regeln
des Spieles hier je verletzt würde, was eben liegt an der extremen Unschärfe.
Und wie ich jedenfalls glaube, gott ein wenig zu kennen (über das Studium von
neem karoli baba), wird diese Unschärfe auch genutzt werden. Wenn keiner mehr
"nachmessen" kann, warum dieses oder jenes von einer KI gemacht oder gesagt
wird, dass ist diesbezüglich natürlich alles offen.
Auch in anderen Bereichen wird es hier schon seit ein paar Jahrzehnten "offener", d.h. es wird nicht mehr ganz so dolle an der Scheinphysikalität von wirklichkeit fest gehalten, man denke an bruno gröning (etc.), aber auch neem karoli baba selbst, an bhagawan nityananda, die NDE und OBE "Reports", welche wie ein Wasserfall herab prasseln in jüngster Zeit, "Findungen" wie von roland plocher, Ing. wilhelm mohorn, johann grander (ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert), Ing herbert renner (und noch viele andere), und halt last but not least das Doppelspaltexperiment selbst, was eben die Grundlage des möglichen Verständnisses all dieser verschiedenen Phänomene liefert.
Diese "Tendenz" also doch recht gut sichtbar ist, das Spiel hier weicht sich in seiner "Physikalität" etwas auf - und das empirisch, also für jeden erfahrbar, nachvollziehbar, jedenfalls der Möglichkeit nach, logisches Vermögen und Hartnäckigkeit vorausgesetzt.

|
Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weißt, kann und wird auf dich zurück schlagen.
neem karoli baba
|
03.08.2025 n. Chr. 07.38 Uhr
Satt Sonne, aber das täuscht dann doch, denn rundherum im Kreisverkehr ist's doch schon recht bewölkt, oder gar regnerisch.
So hatte ich gestern mit patrick telefoniert, der sitzt am Bodensee, und dort war es gegen 19 Uhr regelrecht frisch mit 16°C, während hier oben es noch 22°C hatte. Von der Theorie her müsste es im Süden im Schnitt jedenfalls wärmer sein, doch beobachte ich die letzten Jahre, dass diese Regel häufiger durchbrochen scheint. Beim Wetter herrscht auch enorme Unschärfe, weswegen die Meteorologen immer einen Grund finden werden, warum das "Wetter" so ist, wie es ist. Neben den allgemein bekannten Faktoren dann noch Meeresströmungen, kleinere oder grö0ere Vulkanaktivitäten, Sonnenwinde oder andere kosmische Ereignisse, dann selbst Geoengeneering (meist von den "Truthern" angeführt) und was weiß ich - so gehe ich davon aus, dass man wirklich für ein jegliches, auch noch so absurdes Wetter eine "Erklärung" aus dem Hut zaubern wird. Wie gesagt, die Unschärfe macht es möglich, dass man auch das abstruseste Wetter sich hinplausibilisieren kann.
Und wer "macht" nun das Wetter ?
Nun, auf der Plausibilitätsebene natürlich "Hochs" und "Tiefs" und dahinter eben
die zu "Hochs" und "Tiefs" führenden Faktoren, welche allerdings in einer großen
Unschärfe urständen. Faktisch macht das Wetter wirklichkeit selbst, wie sie es
braucht. Wenn ein neem karoli baba schon für eine Hochzeit auf dem Lande, wo es
keinen Strom, und somit keinen Lüfter oder gar Klimaanlage gibt, die Saison für
2 Tage ändern kann. Im heißesten Sommer:
"treffe Vorkehrungen, es wird kühl werden am 18ten und 19ten""
Aber auch ein wilhelm reich hatte eine "technisch" anmutende Methode gefunden, "Wetter" zu machen. Es funktionierte wohl nicht immer, aber oft, und oft auch spektakulär. So sich roland plocher in heutiger Zeit sich diese Erkenntnisse nutzt, welche wilhelm reich damals nutzte, um Regen zu "machen".
Eine der "Maschinen", die Reich baute, hier ein Relikt von damals, steht noch in Maine, auf dem Gelände des wilhelm reich Museums.
Natürlich waren es nicht die Apparaturen als solche, welche das Wetter veränderten, sondern dass wilhelm reich eine Idee gegeben, und passend zu dieser Idee ein Regelsatz etabliert wurde. Man muß sich das so vorstellen, es werden im Computergame ein paar Zeilen neu geschrieben, wie im Game auf dieses oder jenes Einfluss genommen werden kann. Nun weiß das aber erstmal noch keiner, doch dann, wenn das Programm "steht", erhält ein Teilnehmer im Spiel irgendwie eine "krude" Idee (welche sich genau auf diesen neuen Regelsatz bezieht), und Voila !, kann dadurch Einfluss auf wirklichkeit nehmen, hier auf das Wetter bezogen (Video oben).
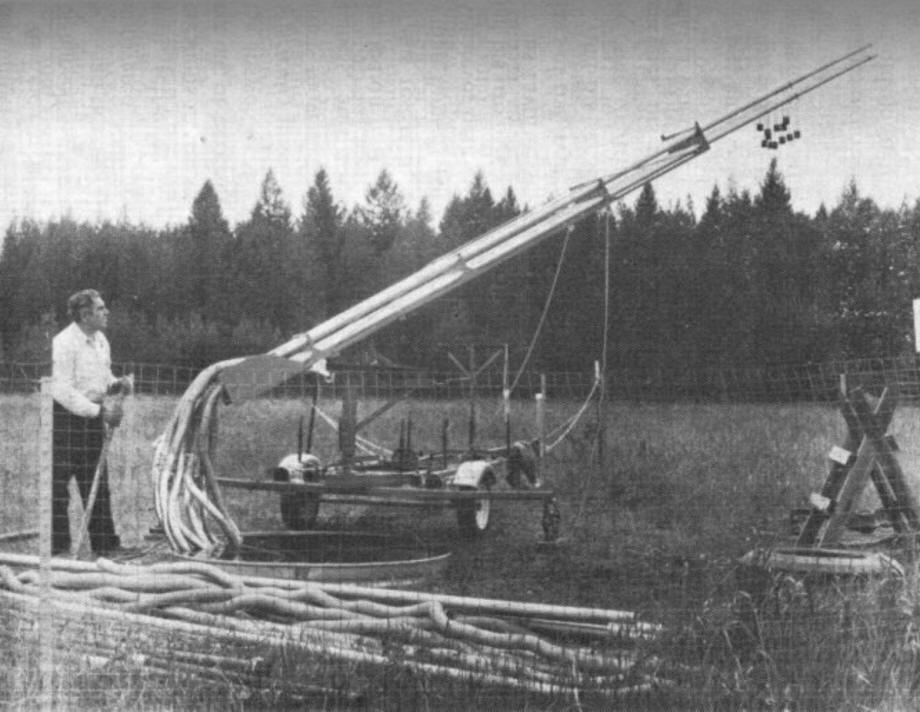
Gut, neem karoli baba brauchte garnichts, aber so lange man fest davon überzeugt ist, dass "da draußen" dieses unglaublich große, materielle Geschehen vor sich geht ("Wetter"), ist eine Einflussnahme darauf plausibel auch nur irgendwie "materiell" möglich. Faktisch braucht es nur einen guten Draht zum Programmierer, und schon wird das Wetter, wie gewünscht, auch wenn es noch so ungewöhnlich ist. Und diese technisch anmutenden Regelsätze bestehen auch heute noch (wer weiß, was noch dazu gekommen ist ?), und werden sich unter anderen auch von roland plocher zu Nutze gemacht.
Dann habe ich wilhelm reich, viktor schauberger und nicola
tesla mir angeschaut,
und bin meinen Weg gegangen
roland plocher
Faktisch ist das in gewisser Art natürlich ein Trugspiel. Ein wilhelm reich, ein roland plocher glaubt, dass es eben diese spezielle Schichtung oder Aufbau von Materialien ist, welche dann für die durchaus sicht- und messbare Veränderung als Ursache herhalten muss, während es halt nicht mehr, als der "programmierte" Regelsatz ist, welcher es im online Game hier so erscheinen lässt, in der wirklichkeit (Monitor, Mattscheibe). So hat krishna das erzählt, dass in den alten Kriegen in Indien, in welchen Pfeil und Bogen das hauptsächliche Kriegsgerät war, die Wirkung des Pfeiles abhängig war, mit welcher Konzentration der Schütze den Pfeil "aufzuladen" fähig war. Der Pfeil hatte also sozusagen eine spirituelle Komponente. Und die so am stärksten von Schützen "aufgeladenen Pfeile" hatten die Wirkung einer (kleinen) Atombombe, so krishna das. Ein vielleicht etwas holpriger Vergleich, doch was er eben nur sagen wollte, ist, dass schlichtweg alles möglich ist hier - es muß nur programmierter Bestandteil dieser wirklichkeit sein (Regelsatz).
Auch oben im Film "wenn der Wassermann kommt", kann man sich die Erklärung von roland plocher anhören, warum er glaubt, dass es funktioniert. Funktionieren "tut" ja seine Methode, nachweislich, auch mit Messgeräten messbar (deutlich), nur man merkt ihm in seiner "Erklärung" an, das er nicht wirklich sicher weiß, warum das alles funktioniert. So ist es ja faktisch so, dass man von hier aus, also dem Sekundären, schlichtweg gar keine Möglichkeit hat, das Primäre zu beeinflussen, man kommt ein Spiel spielend niemals zur Programmebene herunter. Wenn es aber doch so scheint, dann bleibt es letztlich, wie siddhi ma öfter gesagt hat, ein Akt der Gnade. Man "macht" nicht irgendetwas, sondern es wird einem zuteil, durch Gnade. Man erhält eine Idee, nachdem ! der Regelsatz eingefügt ist - und siehe da, in der "wirklichen Welt" zeigen sich die Ergebnisse, es funktioniert. Nur am Ende ist der "Finder" (roland plocher) immer noch ein wenig getäuscht, oder "über's Ohr gehauen", weil es faktisch nochmals ganz anders funktioniert, als er sich hätte ausmalen können. "Hier", im Sekundären, "Emergenten", wie es Chat GPT formuliert, ist nichts zu machen, weil man vom Spiel nunmal nie die Programmebene erreicht. Doch es kann einem die Illusion gegeben werden (plocher, grander, mohorn, aber auch Rituale, Gebete und andere Praktiken), doch letztlich ist alles, wie siddhi ma sagt: Gnade. Wenn "der alte" nicht will oder kein Regelsatz existiert, bringt kein Ritual der Welt irgendwas.
Das sind aber letztlich auch nicht mehr, als logische Implikationen davon, dass diese wirklichkeit eben sekundär ist, abgeleitet, "emergent" (Chat GPT), und urständen muss "woanders" ("in other", edward fredkin, Pioneer der KI, ex Kampfpilot, etc.)
https://www.nytimes.com/2023/07/04/science/edward-fredkin-dead.html
Am Ende ist das Alles garnicht so schwer zu begreifen, man muß nur logisch "am Ball bleiben", und sich nicht davon beirren lassen, dass die "Welt" zu jeder Sekunde so "physisch" wirkt.
Im Anfang war der logos
und der logos war bei gott
und gott war der logos
Die fünf Sinne täuschen uns zu jeder Sekunde, doch da sollte etwas in einem sein, welches sagt: "so ganz kann das aber nicht stimmen ..."
Wir sind fünf Freunde, wir sind einmal hintereinander aus einem Haus gekommen, zuerst kam der eine und stellte sich neben das Tor, dann kam oder vielmehr glitt so leicht, wie ein Quecksilberkügelchen gleitet, der zweite aus dem Tor und stellte sich unweit vom ersten auf, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Schließlich standen wir alle in einer Reihe. Die Leute wurden auf uns aufmerksam, zeigten auf uns und sagten: „Die fünf sind jetzt aus diesem Haus gekommen.“ Seitdem leben wir zusammen, es wäre ein friedliches Leben, wenn sich nicht immerfort ein sechster einmischen würde. Er tut uns nichts, aber er ist uns lästig, das ist genug getan; warum drängt er sich ein, wo man ihn nicht haben will. Wir kennen ihn nicht und wollen ihn nicht bei uns aufnehmen. Wir fünf haben zwar früher einander auch nicht gekannt, und wenn man will, kennen wir einander auch jetzt nicht, aber was bei uns fünf möglich ist und geduldet wird, ist bei jenem sechsten nicht möglich und wird nicht geduldet. Außerdem sind wir fünf und wir wollen nicht sechs sein. Und was soll überhaupt dieses fortwährende Beisammensein für einen Sinn haben, auch bei uns fünf hat es keinen Sinn, aber nun sind wir schon beisammen und bleiben es, aber eine neue Vereinigung wollen wir nicht, eben auf Grund unserer Erfahrungen. Wie soll man aber das alles dem sechsten beibringen, lange Erklärungen würden schon fast eine Aufnahme in unsern Kreis bedeuten, wir erklären lieber nichts und nehmen ihn nicht auf. Mag er noch so sehr die Lippen aufwerfen, wir stoßen ihn mit dem Ellbogen weg, aber mögen wir ihn noch so sehr wegstoßen, er kommt wieder.
franz kafka, Gemeinschaft


09.08.2025 n. Chr. 07.58 Uhr
Gestern bin ich über ein 5 Jahre altes Video gestolpert, mit 192 Aufrufen. Da ging es um eine Rückführung, ein 6-jähriges Mädchen erlebt 1945 in Berlin einen Fliegerangriff, welchen sie nicht überlebt, und also wieder zurück kommt nach, sagen wir mal w5, also wirklichkeit 5, wenn wir das hier als wirklichkeit 6 bezeichnen. Demnach ein wenig näher an w0, welche ein jeder bezeichnen möchte, wie er will. Nur kurz beschreibt sie die "andere Seite" (w5), und dann geht es auch schon los mit der Planung des nächsten Durchganges, welches sorgsam zusammengestellt wird, über "Ereigniskarten", welche sie dann an einer Tafel mit Schlitzen in Reihenfolge des Ablaufs bringt. Auch unterhält sie sich dort mit einer "seele", welche sich für ein leben entschieden hat, in welchem sie gelähmt ist, und welches bis zum 40sten lebensjahre dauert, Dann fragt sie, warum sie das denn so lange mitmachen will, und ob sie die zu machende Erfahrung nicht auch in einer kürzeren Spanne hinbekommen könne, doch erhält zur Antwort, dass es so lange braucht, weil dadurch Mutter und Vater am Ende dann lernen können, was zu lernen ist, und das eben so lange braucht.
Sie .... na egal ich mache es vielleicht in den nächsten Tagen ausführlicher, jedenfalls wird in dieser Rückführung so einiges angesprochen, und vieles "bestätigt", was sich für mich aus der spieletheoretischen Auffassung von wirklichkeit, und leben den logischen Implikationen aus dieser für mich ergibt. Interessant noch insbesondere war das im "Himmel" (w5) geführte Gespräch darüber, dass die eine "Seele" sich ein leben mit Behinderung ausgesucht hat deshalb auch noch, weil ich etwa einen Tag vorher mir selber diese Erinnerung geschickt hatte:
so bescheuert es auch klingt, aber so kann man den ersten Durchgang als schwer behinderter durchhalten ...
... mit dem Verweis auf dieses Video hier:
Und nicht einmal einen Tag später bekomme ich das erste Mal überhaupt eine "Konversation im Himmel" ("w5") mit, welche sich eben genau auf solch ein doch recht schwieriges leben, respektive Durchgang, bezieht (unter anderem). Auch wird dort deutlich, wie bei christian sundberg, aaron green, dass der freie Wille dort besteht, in "w5". Auch erhält "die seele" nachdem das leben mit den Ereigniskarten sortiert, und zusammengestellt ist, das Angebot, es schonmal vorab im Schnelldurchlauf kurz erleben zu können, ob es sich gut und stimmig anfühlt. Und nachdem sie dann sagt, dass es gut ist, stimmig ist - geht es auch schon wieder los, und sie ist im Mutterleib.
Áll das deckt sich eben mit den logischen Implikationen eines Doppelspaltexperimentes, welches ja zu Tage fördert, dass diese uns vorliegende wirklichkeit abgeleiteter, sekundärer natur ist, und hier nichts in dem eigentlichen Sinne geschieht, wie wir "Geschehen" üblicherweise definieren. diese wirklichkeit geschieht "in other" (edward fredkin), und wird dann sozusagen in 3D nochmal gerendert oder verdolmetscht, wo es dann so aussieht, wie eine 3-D-Materiewirklichkeit. es sieht so aus, als geschähe es hier. Doch das eben ist die Täuschung.
Nicht nur der Mond, einfach nichts ist, was es zu sein scheint.
So hatten franzi und ich ja das "Glück", dass uns eben dieser Mond in seiner
digitalen Qualität ganz überdeutlich gezeigt wurde. An einem Vollmondabend im
April 2020 gegen 19.30, ein Tag, an welchem zufällig, das sollte ich 5 Jahre
später feststellen, hanuman gedacht wird. Was für ein Zufall ...
Allerdings, und das setzte ich auch immer dazu - mir hätte man es nicht
notwendigerweise tatsächlich auch zu zeigen brauchen, dass diese wirklichkeit
"digital" ist, und damit sekundär, doch freue ich mich natürlich, dass mir
sozusagen die Gnade erwiesen wurde, diese "Digitalität" einmal "live und in
Farbe" erleben zu dürfen.
Kurz zurück, Abends, die letzte Stunde vor dem zu Bett gehen, lasse ich "mountain hare krishna laufen" (in Wiederholung), und mache mir dann bei Youtube die Shorts an, allerdings ohne Ton. So, dort ist natürlich ein Kaleidoskop von allem Möglichen zu erwarten, doch vor allem - es herrscht enorme Unschärfe, was denn nun als nächstes Kurzvideo kommt.
Und ?
Genau !
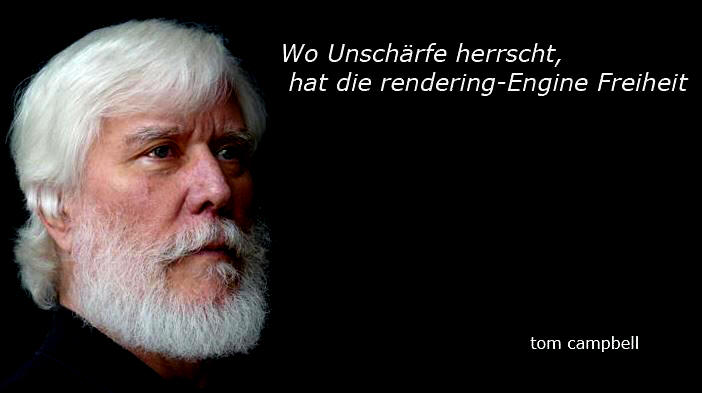
Das heißt, die "rendering Engine" kann mir aus der Unschärfe
heraus jetzt Themen zuspielen, mich auf Einfälle bringen, mir einfach etwas
zeigen, was ich benötige, wie überhaupt die Vorschlagssektionen bei Youtube von
solcher Unschärfe durchzogen sind, dass man ganz unauffällig dahion gelenkt
werden kann, wo man hin soll. Das Alles läuft unter der "physischen
Plausibilität", dass es ja ein "Youtube-Algorhythmus" sei. Gehen sie weiter,
hier gibt es nichts zu sehen.
Doch wenn man halt um die Architektur von wirklichkeit ein wenig weiß, dann ist
einem auch klar, dass sich die "rendering Engine" (tom) die hier herrschende
Unschärfe zu Nutze machen kann. Nicht notwendigerweise stets diese nutzt, aber
eben doch - sie sich für gewisse Zwecke zu Nutze machen kann. Alles möglichst
innerhalb des "plausible deniability"-Prinzips, also dem Prinzip der plausiblen
Leugnung. Heißt, was auch immer geschieht, muss vom Mainstreamer auch physisch
irgendwie "wegerklärt" werden können, mit "Zufall", "kommt aus dem Algorhythmus"
und sonstigen physischen Scheinerklärungen.
So habe ich mit luca schon oft Diskussionen über sai baba
gehabt, welcher ja sehr öffentlich mit seinem "lila" auftritt. Doch eben -
aufgrund der Öffentlichkeit - greift das "plausible Deniability Prinzip" um so
stärker, und demgemäß sein lila wie ein Taschenspielertrick, und dazu noch ein
billiger, aussehen muß. Aber diese Prinzip der plausible deniability zu
verstehen geht auch wirklich erst dann einigermaßen gut, wenn man wirklichkeit
von der "Betreiberseite" und den dahinter liegenden Intentionen und Regeln
begreift. Man muß die spiele- und lernarchitektonische natur von wirklichkeit
schon recht verinnerlicht haben, bis sich einem dann auch die "versteckten
Regeln" auftun, an welche sich wirklichkeit halten muß, um eben halbwegs
konsistent und "physisch" weiterhin zu erscheinen. Hat man einen "Schwellenwert"
überschritten, so dass klar ist, "die werden nie wieder davon zu überzeugen
sein, dass das hier physlich echt ist", erhält man eben vielleicht auch eine
Bestätigung (durch Gnade ?), dass man sich in einem "digitalen Umfeld" hier
befindet, wie es bei franzi und mir geschah, dass uns diese Digitalität
überdeutlich gezeigt wurde.
Gib mir einen festen Punkt, auf den ich hintreten kann, und ich hebe die Welt aus den Angeln
dos moi pou sto kai kino tēn gēn - Archimedes


10.08.2025 n. Chr. 08.41 Uhr
In seiner Autobiografie beschreibt wheeler, wie
er nacheinander von drei metaphysischen Ideen erfasst wurde: Alles ist Teilchen,
alles ist Feld und schließlich, am Ende seiner Karriere, alles ist Information.
Zu dieser letzten Idee schrieb Wheeler: „Je mehr ich über das Geheimnis der
Quantenphysik und unsere seltsame Fähigkeit, die Welt, in der wir leben, zu
verstehen, nachgedacht habe, desto mehr sehe ich mögliche grundlegende Rollen
für Logik und Information als Fundament der physikalischen Theorie.“
william dembski*, „How Informational Realism Dissolves the Mind–Body
Problem“ in /Mind and Matter: Modern Dualism, Idealism and the Empirical
Sciences
Nahezu ein jeder, welcher zu Lebzeiten mal diese wirklichkeit per NDE verlassen konnte, spricht von der "anderen Seite" mehr oder minder als dem reinsten Himmel. So will ja auch kaum einer hierher wieder zurück, weil sie es von dieser anderen Warte aus als "Horror" oder jedenfalls Tortur ansehen. Nun stellt euch vor, diese wirklichkeit gibt es noch nicht, und alle "seelen" verbringen ihre Zeit ausschließlich im "Himmel", kennen nichts anderes. Auch gott kennt (noch) nichts anderes, bis "er" schließlich entdeckt, dass sophia, ein Äon, sich da was ausgedacht hat (eine wirklichkeit, eine lernumgebung) in welcher es überwiegend alle andere als liebevoll und harmonisch zugeht, sondern ganz im Gegenteil, stressig, voll von Angst, Leid, Schmerz, Trauer, Zweifel. Grübelei, und so fort. Wie nimmt sich solch eine wirklichkeit aus, neben derjenigen, welche man ja als bisher einzige kennt ? Genau, wie eine fürchterliche Idee, wie ein Monster, was erschaffen wurde. Und genau das soll gemäß der Gnosis (wie alles angefangen hat) von johannes gott zu sophia gesagt haben, als "er" mitbekam, was sie sich da ausgedacht und geschaffen hatte. Und dieses Monster wurde yaldabaoth genannt.
Von allen Theorien, welche es "da draußen" gibt, darüber, wie
diese wirklichkeit entstanden ist, ist das die bisher stimmigste, welche ich
kenne.
- sie passt mit den empirischen Fakten überein (Doppelspaltexperiment, bruno
gröning, therese neumann, maharaj ji etc.)
- sie redet von einer Schöpfung im Primären (wie es nicht anders sein kann)
- sie enthält den Aspekt einer geschaffenen Lernumgebung
- sie erklärt, warum z.B. ein christian sundberg auf dem Weg hierher sich doch
wieder "zurückgekämpft" hatte
- sie lässt mühelos das Zähe, Stressige, Leidvolle, "Böse" (usw.) integrieren,
wie ein eingebautes Programm, ein "Monster" halt ...
Sie stimmt sogar mit der "flachen Hierarchie" zusammen, von welcher tom spricht, also dass nicht so sehr viele wesenheiten noch unter gott sind, bevor wir dann zu dieser gegenwärtige wirklichkeit gelangen.
Es passt zu dem hier:
Zu dem:

Zu dem
Dem ...

Naja, und so weiter, ich denke, jeder könnte noch hunderte weitere Beispiels anfügen. Schaut man sich die (virtuelle) Geschichte an, so wird man finden, dass sich im Kern an der wirklichkeit, also von ihrem Wesen her, überhaupt nichts geändert hat. Man atmet, daraufhin entsteht die Notwendigkeit zu essen, zu trinken, ggf. für Wärme zu sorgen, auf Deutsch, mit dem Atmen beginnt der zweifelhafte Spaß, hier Teil zu nehmen.
Halt ein "Monster", was sich sophia ausgedacht hat, nachzulesen
in Nag Hammadi, gleich das erste Kapitel, soviel ich noch weiß.
https://www.amazon.de/Nag-Hammadi-Deutsch-Studienausgabe-Berolinensis/dp/3110312344
Wie gesagt, von allen Theorien ist das noch diejenige, welche am besten übereinstimmt mit demjenigen, was wir hier ganz faktisch und für jeden erlebbar vorfinden. So wir (hier) ja wissen, diese wirklichkeit ist "Screen", Mattscheibe und im Kern "digital" (diskret, Quantum), zudem generiert sie sich nicht selber, sondern ist "emergent" (Chat GPT), was auch nur bedeutet, dass faktisch wirklichkeit nicht hier geschieht, urständet, sondern "woanders" (in other, edward fredkin). Damals, als die ersten Erkenntnisse über die diskrete natur von wirklichkeit sich zu etablieren begannen, sagte man, dass wenn man in die Nähe der planck-Zeit und der planck-Länge kommen könnte (mit Instrumenten), wirklichkeit würde ruckelig werden, und granular.

Genau so waren eben auch die ersten Video-Games (lat. inf. videre = sehen, video= ich sehe). Granular, und ruckelig. So, aber nun ist die Frage, wenn diese Theorie stimmt, nach welcher sophia, ein Äon, sich diese wirklichkeit so ausgedacht hat, deren Kern ja darin besteht, dass es hier halt im Normalfall mindestens stressig, im Extremfall aber auch wie in der "Hölle" zugehen kann - warum sollte an diesem wirklichkeitskonzept sich überhaupt etwas ändern ? Offensichtlich ist es ja erfolgreich, und es besteht ein Bedarf nach genau solch einer wirklichkeit. Gäbe es sie nicht mehr, weil hier "der Himmel auf Erden" einkehren würde - man müsste wieder eine neue wirklichkeit wie diese aufsetzen, weil ja eben der Bedarf da ist. Also warum nicht gleich diese so belassen, wie sie ist ?
Das ist, was ich den "Spirituellen", aber auch tom campbell und ähnlichen Protagonisten in gewissen Sinne vorwerfe, sie denken einfach die Dinge nicht zu Ende. Was ist denn, wenn hier Friede Freude Eierkuchen eintreten würde ? Genau, dann wäre noch immer der Bedarf an solch einer schroffen wirklichkeit, wie es diese ist, da - doch sie gibt es ja nicht mehr. Also müsste, um den Bedarf zu decken (also für diejenigen, die es hart brauchen oder wollen), wieder eine neu geschaffen werden. Da kann man auch gleich die alte bestehen lassen, ist ungleich effizienter.
Erst dann ! wird ein Schuh draus, wenn es keinen Bedarf mehr geben sollte. Doch mich deucht, das wird nicht geschehen, zu reizvoll dürften solch "monströsen" wirklichkeiten wie diese sein, gerade in Anbetracht dessen, dass einem ja faktisch überhaupt nichts passieren kann. Klar im Spiel stirbt man durch eine Granate, wird vom Auto überfahren, hat Krebs, ist gelähmt, oder was weiß ich. Doch letztlich weiß man auch, dass man aus dem Theater wieder wohlbehalten heraus kommen wird.

Courage is important
maharaj ji
There's only one Antidote to Fear, and this is: Courage
tom


29.08.2025 n. Chr. 08.14 Uhr

Mehr hat neem karoli baba ja nicht empfohlen, wenn überhaupt er mal Empfehlungen aussprach. Es gab keine "Lehre" sonst weiter. So hat es sowohl krishna das als auch ram dass oft formuliert, es war bei ihm einfach ein "hanging out", also auf Deutsch war es mehr oder minder ein abhängen, man lungerte rum, rund um um maharaj ji. Und wenn du versuchtest, dich in den Lotus-Sitz zu begeben, und zu meditieren, dann hat er dich mit Äpfeln beworfen, oder dir irgendwelche Fragen gestellt, wieviel Geld du in Amerika verdienst.
Die meisten "Westler", die ihn besuchten, waren ja noch jung, und maharaj ji sagte zu ihnen, dass sie sich fühlen sollen, wie bei ihrem Opa. Also sie brauchen nicht abwaschen, nicht mithelfen, sie bekommen was zu essen, zu trinken, brauchen aber sich auch nicht um das Geschirr zu kümmern, so wie bei den Großeltern es normalerweise zugeht (ich kenne das noch so). Bei den Großeltern hat man einfach abgehangen ("hanging out"), würde "betütelt" mit Essen und Trinken, Opa hat vielleicht noch etwas Schabernack mit dir getrieben, und dann ist man wieder nach Hause.
"Überleg' mal, wie es sein muß, gott zu sein ..."
krishna das, bezogen darauf, dass sich maharaj ji immer wieder an den Kopf fasste wegen des Verhaltens der "Westler"
Von "hier unten" aus ist es schon gut verständlich, wenn man ein wesen mit "gott" betitelt, welches alles weiß, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, also somit auch deine Gedanken kennt, deine Vergangenheit, deine Zukunft, fähig ist, gerade Verstorbene wieder zum leben zu bringen, und was weiß ich noch alles. Vielleicht sollte man das nicht machen, es wirkt ein wenig "übergriffig", doch verständlich finde ich das dennoch. Man muß bedenken, man ist hier unten "eingekerkert", hat von der übergeordneten wirklichkeit so wenig Schimmer, wie das Bakterium im Magen vom Nahrungsanbau, und nun ist da jemand, der zu dir, dem Bakterium im Magen, sagt, dass bald Nahrung kommen, und das es diese oder jene sein wird. Woher weiß der das ? Nun, offensichtlich hat er irgendwie Einblick außerhalb dessen, was bloß im Magen (der "Welt") so vor sich geht. So finde ich das jedenfalls nur allzu verständlich, wenn es mal "rausrutscht" und man neem karoli baba mit gott (shiva) vergleicht, wie es in der Tat nicht wenige seiner indischen Anhänger. Obwohl die Meisten ihn für eine Inkarnation (in's Fleisch des Videogames springend) von hanuman halten. Nun ja, die von maharaj ji gebauten Tempel waren ja auch nahezu alle hanuman gewidmet.
Kommen wir hier aus dem "Magen" wieder heraus, sehen wir vielleicht neem karoli baba aus einer etwas anderen Perspektive, doch unzweifelhaft muss er Qualitäten seines wesens haben, welche uns allen abgehen. So sind wir anscheinend noch überhaupt gar nicht in der Lage, von der Qualität unseres wesens her, "gott" im Videogame spielen zu dürfen (mit allen Freigaben).

Nur, was sicht bar wird, so finde ich, ist die "flache Hierarchie", wie tom es nennt. Das uns faktisch nicht tausende von Ebenen uns vom göttlichen trennen, sondern uns doch relativ nahe ist. Und auch gar nicht "da draußen", sondern, wie Meister eckhart schon formuliert, im Inneren zu finden.
Auf Empfehlung schopenhauers hatte ich damals meister eckhard gelesen, als auch den sehr ähnlich gelagerten angelus silesius, und beide haben mir gefallen.
Wo läufst du hin, der Himmel ist in dir.
Das "die Hierarchie" recht flach ist, und jedenfalls eine übergeordnete wirklichkeit recht nahe, wird uns durch die NDEler, remote viewing, sehen ohne Augen, roland plocher oder eben auch solche Ausnahmeerscheinungen wie maharaj ji, aber auch brono gröning und selbst einem alois irlmaier (nebst anderen) recht eindrucksvoll gezeigt. Äußerlich sind sie - wie wir - ein einfaches Bakterium im Magen, scheinen aber dann doch nicht ganz so beschränkt, also borniert zu sein, wie wir, die halt von einer übergeordneten wirklichkeit keine Kenntnis erhalten. Die "Freigabelevel" sind freilich verschieden, doch könnte man vermuten, dass je mehr Freigaben man erhält ("God Mode" genannt in Computerspielen), desto "abgerundeter" das wesen dahinter ist.
Im Gegensatz zu allen (fast) anderen mir bekannten Ausnahmeerscheinungen scheint maharaj ji in dieses online Game einfach mehr aus dem Grunde herein gesprungen zu sein, um etwas "Fun" zu verbreiten, auf eine völlig zwanglose Art und Weise. Der Godmode ...
|
Seine Güte gegenüber seinen Anhängern zeigte sich auch darin, dass er ihre sehnlichen Erwartungen erfüllte und versuchte, sie vor Enttäuschungen zu bewahren...
|

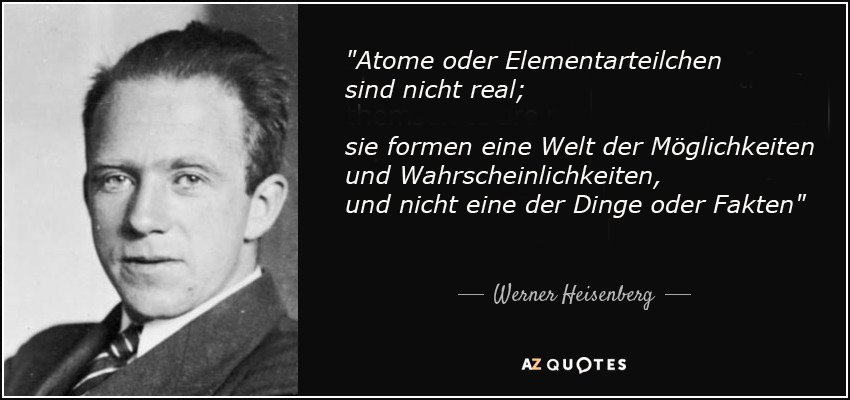
15.09.2025 n. Chr. 09.06 Uhr
Glück gehabt, es ist nicht ganz so spät, wie erwartet. Es ist halt blöd, wenn man nachts aufwacht, dann in's Denken und Grübeln kommt, und einfach für ein paar Stunden nicht wieder einpennt Doch zu schreiben gibt es ja eh' nicht mehr viel, oder jedenfalls erstmal für mich nicht. Denn wenn man im virtuellen Hinterkopf behält, dass halt die Bühne immer mehr oder minder anstrengend und nervig gestaltet sein muß (zu Lernzwecken), und man dann entsprechend an diesen oder jenen unangenehmen Erfahrungen schlichtweg nicht umhin kommt, bleibt ja nichts weiter, als dass man zu dem Schluss gelangt, es ist schon in Ordnung so, wie es ist. Eben: egal, wie es ist.
Irgendwas passiert, und nun musst du damit klar kommen, so gut du kannst.
tom campbell
Nach der Sammelalbum-Theorie hat man dann eben diese Ereigniskarte abgearbeitet, so man sie abgearbeitet hat. Dann wird diese im Sammelalbum verbucht, und kommt so nicht mehr vor.
ich kann mich erinnern, sowohl Gefolterte, als auch mal
Folterer gewesen zu sein,
an beides erinnere ich mich nicht gerne.
bettina suvi rode
Die Sammelalbum Theorie hat auch noch den Vorteil, dass sie selbst dem (objektiven) Zufall noch einen richtigen und guten Sinn abgewinnt. Nehmen wir an, die Würfel sind grad richtig blöd gefallen, und sie verwickeln dich in einen Autounfall, welcher dich querschnittsgelähmt zurück lässt. Natürlich ist das mit einer der übelsten Schicksale, doch mit Glück lernst du dich zu arrangieren, gewinnst gar Freude zurück. Und am Ende hast du es geschafft, Eindrücke und Erfahrungen aus einer Perspektive heraus zu sammeln - also informationen - welche die Allermeisten eben nicht hatten sammeln können.
Die Sammelalbum-Theorie besagt auch, dass ein jeder durch Alles
einmal "durch" muß. Und das macht richtig Sinn, weil die Erfahrung dann
"holistisch" wird. Nicht wenige der NDEler haben teilweise bis zur NDE einen
schmerzhaften Leidensweg (Krankheiten), und dann in der NDE wird ihnen
empfohlen, Therapeut oder generell Heiler zu werden, welches Los sie dann auch
zumeist ergreifen, und sehr erfolgreich sind. Eben weil sie diese Leiden
aus der Innenperspektive kennen gelernt haben.
In der Theorie hat das Sammelalbum auch Kapitel. Es ist nicht so, dass es ein
riesiges Album ist, und nun egal wo es sich zu füllen hat, sondern es füllt sich
erstmal das erste, und wenn das dann vollständig erlebt ist, beginnt das
nächste. Das ist dann ganz so, wie die "Level" bei gewöhnlichen Computerspielen.
Und jede Schule, Lehre, Studiengang ist ja letztlich genau so angelegt, was
spricht also dagegen, dass eben auch Inkarnationen einem ähnlichen Muster folgen
?
"Es ist hier so, wie in der Schauspielschule. Es wird
gefragt,
wer diesmal MacBeth spielen will, und du hebst die Hand"
ram dass
Oft zitiert von ram dass:
Sag nicht, dass ich morgen fortgehen werde –
selbst heute komme ich doch immer noch an.
[...]
Ich bin das Kind in Uganda, nur Haut und Knochen,
meine Beine so dünn wie Bambusstöcke.
Und ich bin der Waffenhändler,
der tödliche Waffen nach Uganda verkauft.
Ich bin das zwölfjährige Mädchen,
Flüchtling in einem kleinen Boot,
das sich ins Meer stürzt
nachdem es von einem Seepiraten vergewaltigt wurde.
Und ich bin der Pirat,
mein Herz noch nicht fähig,
zu sehen und zu lieben.
Ich bin ein Mitglied des Politbüros
mit reichlich Macht in meinen Händen.
Und ich bin der Mann, der meinem Volk
seine „Blutschuld“ zu bezahlen hat
und langsam in einem Arbeitslager stirbt.
[...]
Thich Nhat Hanh
Hier vorgelesen: https://www.deutschelyrik.de/files/Andere%20Gedichte/bitte_nenne_mich_bei_meinen_wahren_namen.mp3
Ganzer Aufsatz und Quelle: https://www.deutschelyrik.de/bitte-nenne-mich-bei-meinen-wahren-namen.html
Für mich macht es Sinn, dass jede "iuoc" (tom) eben einmal das gesamte Kaleidoskop erleben muß. Wie soll man wissen können, wie es ist, als Mörder noch weiter leben zu müssen, wenn niemand sich je bereit erklären würde, den Part des Ermordenden, Ermordeten zu übernehmen ? Klar. man könnte auch sagen, dass ja ein NPC den "Ermordeten" übernehmen kann, für den Mörder macht es keinen Unterschied für den anschließenden Lebenslauf, doch was ist, wenn es "auf der anderen Seite" gut passt, und eine IUOC nicht so lange diese oder jene Figur inne haben möchte ? Da passt dann ein Mord gut hinein in's "Konzept", und man ist recht früh wieder heraus aus dem Spiel.
Immer dran denken- hier
geschieht im Sinne des Wortes "Geschehen": garnichts.
Hier ist bloß: die Mitteilung des Geschehens
Und jetzt nochmal ein Bonmot zum Schluß, krishna das auf der Bühne zu Tränen gerührt, als er die Geschichte von larry brilliant und neem karoli baba vorliest ! So larry sich mit seiner Frau verabschieden will, nachdem neem karoli baba ihn ~9 Tage lang am Stück ignoriert hat. Er will höflich sein, sich verabschieden, aber die Sache auch nochmal mit ihm "ausmachen". Mit neem karoli baba etwas "ausmachen", jaja, eine gute Idee ...


17.09.2025 n. Chr. 08.00 Uhr
|
|
Wach geworden, doch hätte die Sonne nicht so einladend durch die Fenster sich in der Bude breit gemacht, ich hätte mich wieder hingelegt. So allzu super viel ist ja auch nicht mehr zu sagen, selbst ein tom cambell, ein krishna das wiederholt sich dann irgendwann, wenn das Essentielle gesagt ist. Das tägliche, äußere, weltliche Theater nehme ich zwar am Rande noch immer zur Kenntnis, doch es folgt ja nach wie vor dem Drehbuch, welches ich vor etwas längerer Zeit mal öfter am Wickel hatte, nämlich das schlichtweg alles nur immer absurder, irrer, stressiger werden wird. Nimmt man einfach die empirischen Fakten vom Boden, passiert genau das. Nicht wenige ja sagen, dass sich sich fühlen, als würden sie das Ganze nur träumen. Oder Kommentare zum "Weltgeschehen" zu lesen sind, dass viele "im Traum das nicht gedacht hätten", dass die "Welt" derart irre werden kann. Und genau das ist ja DAS Kennzeichen eines Traumes, seine Absurdität.
Hier, darüber bin ich gestern gestolpert, weil halt tom auf dem
Titelbild war. Inhaltlich nicht wirklich klar und konsistent, einiges auch
schlichtweg falsch (was z.B. den Tenor der NDEs betrifft), und in dem Brustton
der Überzeugung eher verwirrend für denjenigen, welcher über kein stabiles
Gerüst seiner Gedanken verfügt. Doch etwas wird gleich am Anfang angerissen, was
mich ja zu den Artikeln "gibt es ein leben vor dem Tod ?" inspiriert hat,
nämlich, dass wir hier, in dieser wirklichkeit letztlich im "unlebendigsten"
Zustand befinden. Wie ja die NDEler unisono berichten, die OBEler zum Teil, die
Psychonauten - was man so außerhalb dieser wirklichkeit erlebt, erleben kann,
fühlt sich um einiges echter an, als eben diese wirklichkeit. Die NDEler, wenn
wieder zurück, empfinden diese wirklichkeit danach als Traum. Sie sind also kurz
aufgewacht, haben "die wahre" wirklichkeit kurz wieder erleben dürfen, sind dann
aber wieder "eingeschlafen", und träumen ihren "hier-Traum" nun weiter.
Das ist eben auch der Grund, weswegen ich schon seit längerem sage, dass "der
Tod" hier ist, wir sind mitten drin, im "Reich des Hades", sozusagen.
paradoxa sigillum veri
Das Paradoxe ist das Siegel der Wahrheit, oder mit matt ausgedrückt: "wenn es nicht total paradox klingt, ist es nicht einmal in der Nähe der Wahrheit". Die Angst vor dem Tod ist dann also nicht mehr, als die Angst davor, dass man wieder aufwacht, und der Traum schlichtweg nun einfach vorbei ist. Echte Wissenschaft (DSE, DQCEE etc.) wie die logischen Implikationen daraus lassen letztlich keinen anderen Schluss zu, und die empirischen Fakten, von neem karoli baba zu bruno gröning und so weiter, unterstützen diese Einsicht in einer grandiosen Weise. So sage ich desöfteren "w.z.b.w", also: was zu beweisen war.
"Die Abkürzung WZBW steht entweder für "was zu beweisen war" oder "was zu zeigen war", eine mathematische Formulierung, die das Ende eines Beweises signalisiert, vergleichbar mit dem lateinischen "quod erat demonstrandum" (Q.E.D.)"
Und in eben diese Richtung geht dieses Video, welche ich mir 2x angehört, und dann entschieden habe, es (doch) hier zu bringen, obwohl es nicht so konsistent ist, wie man etwa von tom gewohnt. So hat das tom auch nicht gesagt, dass hier "der Tod" ist, respektive "das Reich des Hades", doch tatsächlich könnte man es aus streng logischen Erwägungen heraus so formulieren, denn, was uns nach diesem Traum erwartet, ist halt nur echter, als dasjenige, was wir gerade erleben.
Die Kommentare sind teilweise sehr lesenswert, auch aus empirischen Gesichtspunkten heraus. Hier nur einer, aber unter dem Video (700000 Aufrufe, 3600 Kommentare) finden sich noch eine Menge mehr !
Ja, so bin ich angefangen, das Gröbste ist gesagt. Nicht umsonst sich dann ab einem gewissen Level letzutlich alle sich wiederholen, und die Empfehlungen zum Beispiel immer einfacher werden.
"feed the People"
maharaj ji
Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, es ist zu offensichtlich, und dadurch versteckt sich die Einfachheit (wird auch im obigen Video angemerkt). "Neem karoli baba war ein Siddha, kein Siddhi", krishna das, womit er verdeutlichen wollte, warum es bei neem karoli baba keine "Lehre" mehr gab, bis halt auf diese paar Sätze, wie "ernähre die menschen", "helfe den menschen", "sage Wahrheit" und letztlich "erinnere gott". Das war sozusagen "das Theoretische". Der Rest war echte, angewandte Praxis.

Wie war das noch bei "Inception" ?
"Die kommen also jeden Tag hierher, um zu träumen ?"
"Nein, sie kommen hierher, um aufzuwachen"
https://youtu.be/K_M201T-UsQ?t=113
Nach "Durchsicht der letzten Rechnung" (kafka-Poseidon) kann man es garnicht mehr anders formulieren, als das wir hier jetzt gerade uns im eigentlich unlebendigsten Zustande befinden. Naturgemäß würden wir das als das "Totenreich" bezeichnen. Nur, es ist eben: hier. So hat es william buhlman immer die "outer crusp" genannt, also die unwirklichste aller wirklichkeiten. Echte Wissenschaft, angewandte Logik und Empirie sprechen eine deutliche Sprache, wir sehen nur den Wald vor lauter Bäumen nicht (mehr). Zu tief eingebettet sind wir in den Traum ...

20.09.2025 n. Chr. 07.38 Uhr
Würde die Sonne und der Himmel nicht diesen schönen spätsommerlichen Anblick liefern, ich wäre wohl nicht aufgestanden. So geht es jedenfalls mir in diesen Zeiten, dass es so gut wie nichts (mehr ?) zu verpassen gibt. Doch die trüben und dunklen Tage sind ja nicht mehr so weit entfernt, da wird sich noch die eine oder andere Gelegenheit ergeben, ohne Reue einfach liegen zu bleiben. Dass der Sommer sich übrigens so präzise auf den 21. September verabschiedet, scheint mir nicht dem "Zufall" von Hochs und Tiefs, Verdunstung und sonstwas geschuldet zu sein. Wie es aussieht, ist heute erstmal der letzte schöne Tag, für eine ganze Weile, naja, es ist ja auch "§offiziell" der letzte Sommertag.
Erstmal, auf der Plausibilitätsebene, sind es natürlich die
unterschioedlichsten irdischen Faktoren, welche das Wetter machen, ein komplexes
Zusammenspiel, jedenfalls sieht es ganz so aus, und beschäftigt ja auch Tausende
von Meteorologen. Doch unter dem Strich, in dem Sinne von Existenz, gibt
es ja "den Luftruck", "die Luftfeuchtigkeit", "die Sonneneinstrahlung" und all
den Käse nicht. Warum ist es hier grad so schön ?

Wegen dem "Hoch" ? Weil die Sonne aufgeht ? Natürlich nicht. Das
Wetter im Game ist so, wie es grad sein soll (aus welchen Gründen auch immer),
daher natürlich auch die Aussage von irlmaier, dass im Süden irgendwann Orangen
wachsen werden (weil das Wetter sich so krass ändert), ohne irgendwelche
Probleme leicht eintreten kann. Die "Meteorologen" werden dann schon einen Grund
finden, warum es so ist. Dann gibt es irgendwelche Begründungen mit reichlich
willkürlich eingebauten "Flutschfaktoren" zur Erklärung, die "Wissenschaft" ist
ja voll von diesen Flutschfaktoren (tom), also Dingen, die man sich einfach
ausdenkt, damit das Ergebnis passt. Letztlich mach natürlich die information,
respektive das Spiel selbst das Wetter, etwas anders als information existiert
hier ja nicht.
Hat man natürlich einen "guten Draht zum Programmierer", sieht das schon wieder anders aus ...
Die Rubrik "physisch (erklärbar) ist: garnichts
ist und bleibt einfach eines meiner Lieblingsthemen.
Denn es gibt ja auch kaum ein Thema, welches einen solchen Kontrast aufwirft. Die Logik, welche die Implikationen aus den echten Wissenschaftlichen Empirie nur "zu Ende denkt", sagt glasklar, mit dem "hier" muß es sich um eine sensorische Illusion handeln, hingegen die 5 Sinne zu jeder Sekunde dir verdeutlichen, wie (scheinbar) echt und "physisch" es hier doch ist. Doch am Ende muß einfach die Logik obsiegen, so sehr anders es sich auch anfühlt, das "hier".
Im Anfang war der Logos.
Und der Logos war bei gott.
Und gott war der Logos.
luther hat da übrigens den menschen einen Bärendienst erwiesen, als er "logos" mit "Wort" übersetzte. Sonst hätte man vielleicht schon viel eher drauf kommen können, was die Grundlagen dieser Veranstaltung hier sind. Er hätte einfach logos stehen lassen sollen. Der Sprung von "logos" zu "information" ist nämlich weitaus natürlicher, als der Sprung von "Wort" zu "information", denn bei Wort biste erstmal bei Begriff, dem Begreifen, dem Intellekt, der Anthropomorphismus (Reden, Mund, Schrift etc.) - und die ganze Sache beginnt, schwammig zu werden.
Ist man dann angelangt bei "alles, was ist, ist information, der Rest ist Illusion" (tom), beginnt diese wirklichkeit hier sich ganz zwanglos von selbst zu erklären, auf einmal passt alles, das Doppelspaltexperiment, bruno gröning, mirin dajo, maharaj ji, was roland plocher macht, johann grander, und wohl noch hunderte andere (Phänomene).
"ich nehme zur Kenntnis, das es so ist, wie es ist - wir
haben im Instandhaltungsbereich
keine Aufwende mehr, ich habe Maschinen, die perfekt laufen
... äh, ob es jetzt erklärbar ist, oder nicht, ist ... ist mir eigentlich egal"
https://www.grander.com/international/grander-wasser/ueber-grander/johann-grander
Übrigens bin ich vor ein paar Tagen auf eine "neue" Idee
gekommen, warum eigentlich die Produkte von etwa johann grander oder roland
plocher nicht an den Universitäten untersucht werden. Denn immerhin liefern sie
sie ja ganz klar messbare, empirische Ergebnisse, und wären doch insofern als
"Sensation" zu sehen, da sie ja alle (klassische, newtonsche) "Physik" über den
Haufen werfen würden. Eine ganze Weile lang habe ich hinter diesem Phänomen
(dass das einfach nicht untersucht wird) menschliche oder auch "okkulte" Gründe
vermutet, doch irgendwann vor ein paar Tagen kam es mir, dass es schlicht das
spiel selbst, oder wirklichkeit selbst ist, welches das verhindert.
Warum ?
Darum:
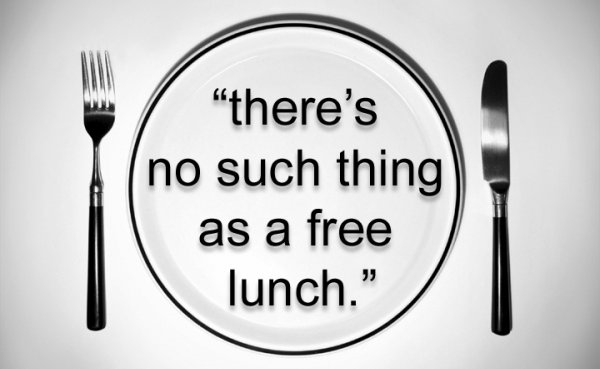
So, genug geschrieben für heute, gestern übrigens gab es auf der Fähre dann neben dem schönen Wetter noch ein weiteres "Highlight", nämlich ein schwerer LKW mit einer ordentlichen Ladung auf der kleinen Fähre. Der Fahrer stoppt auf der Fähre etwas zu früh, daher sie noch aufsitzt, und nicht weg kommt, der Fahrer dann ganz nach vorn zur Schranke noch fährt, damit die Fähre sich hinten etwas anheben kann. Doch robert und "der Chef" meistern das souverän :-)


04.10.2025 n. Chr. 08.03 Uhr
Es sieht so aus, dass jegliche sich uns präsentierende wirklichkeit, welche Form sie auch haben mag - immer virtuell ist.
Da gibt es kein Hinaus, Bewusstheit und Virtualität bedingen einander.
Deswegen das "Sein" als solches nie Gegenstand einer wie auch immer gearteten Wahrnehmung sein kann.

Heute bleibt es zumeist bewölkt, und im Norden, wie man sieht, gibt es reichlich Regen.
Gestern habe ich dann nochmal in dolores cannon hinein gehört, noch einmal das gleiche Thema, benahe auch genau derselbe Wortlaut, doch so ist das eben, wenn man mit den Workshops von Stadt zu Stadt tingelt, und halt immer wieder das gleiche erzählt, oder erzählen muß. Jedenfalls hatte ich gestern dann etwas mehr einen Begriff davon bekommen, was sie so macht, und da waren für mich interessante Inhalte dabei. Sie macht Rückführungen in vergangene, bereits abgeleistete Durchgänge ("Leben"), um dort die "karmischen Ursachen" für die Schwierigkeiten im gegenwärtigen auszumachen. Sie nennt sich deswegen auch Therapeutin, versucht also zu heilen mit dieser Methode. Auch wenn sie das so nicht erwähnt, fällt mir grad spontan fibonacci ein, jeder Durchgang ("Leben") baut auf dem vorherigen auf.
Naja, jedenfalls dolores cannon nicht nur den vorherigen Durchgang, das "Gelebte" sozusagen, wieder hoch holt, sondern auch dasjenige, was danach kommt, bis man eben wieder sich bereit erklärt, mit einem neuen, weiterführenden Durchgang hier im Traum wieder aufzuschlagen, und an dieser Stelle beginnt es für mich, interessant zu werden.
Nämlich ...
während die tausenden von Nahtoderfahrungen nicht wirklich EINE konsistente wirklichkeit nach dieser wirklichkeit hergeben, sondern beinahe so viele verschiedene wirklichkeiten zu existieren scheinen, wie es NDEs gibt, so zeichnen die Rückführungen von dolores cannon ein völlig anderes Bild. Aus ~ 40 jähriger Arbeit mit wohl tausenden von Patienten, ergibt sich, dass es eine überschaubare Menge von wirklichkeiten gibt, nämlich 3, welche nach dem Durchgang hier zur Verfügung stehen. In welche man zunächst gelangt, hängt ab davon, wie man hier zu Lebzeiten "drauf" war. Es gibt eine hemdsärmelige wirklichkeit, dann eine harmonische, und dann eine, welche mehr dem Dazu-lernen gewidmet ist und sich einem Studium hingeben kann, wie wirklichkeit aufgebaut ist, und noch mehr (für die ganz Rastlosen, sozusagen).
Und in diesen "astralen" wirklichkeiten geht es konsistent zu. Die Beschreibungen derjenigen, welche in die "höchste" wirklichkeit gelangen konnten, decken sich sämtlich, also, wie es dort aussieht, wo welche Lernmöglichkeiten existieren, wie diese genau aussehen, was für Gebäude es gibt, etc. Das ist ein großer Gegensatz zu den NDEs !. Doch man muß sich das jetzt einfach mal rein datentechnisch anschauen, dolores bringt ihre Patienten dazu, den vorherigen Durchgang sich anschauen zu können, aber eben inklusive allem, was so alles geschieht, bis man dann wieder unten im Traum aufschlägt, um an gewissen Schwächen seines wesens zu feilen.
Interessanterweise decken sich ihre Aussagen, oder vielmehr diejenigen ihrer Klienten, mit denen von aaron green und christian sundberg, welche immerhin ein paar Momente noch in "Erinnerung" haben, bevor es wieder hierher zurück ging. Das ist es, worauf ich immer sehr stark achte, wie konsistent Berichte sind, und eben auch, wie gut sie zu einem logisch-effizienten, wie intelligentem System passen. So würde ich mich nicht dazu verleiten lassen, dass es so ist, wie dolores aus ihrer Jahrzehnte langen Praxis zu berichten weiß, sondern klopfe diese Information mehr aus der Perspektive ab, ob es Sinn macht (wenn ich etwa der Spielebetreiber wäre, oder die lcs oder gott oder oder).
Auch würde ich wetten, dass es nicht nur diese 3 "Auffangwirklichkeiten" gibt. Die dürften für "Normalsterbliche" gedacht sein. So kann ich mir nicht vorstellen, dass ein mahara ji, ramana maharshi, nityananda auch nur mit der "höchsten" dieser 3 astralen wirklichkeiten nach dem Durchgang hier zu "dealen" haben . Aber gut, mehr als diese 3 haben wir von dolores nicht im Angebot, müssen also nehmen, was da ist. Sollte aber auch reichen, denn wir wohl alle uns zu den Normalsterblichen zählen können. Es passt übrigens auch zu einer Erzählung von william buhlman, welcher mal in der unteren "astralen" Ebene unterwegs war, und diese nicht wirklich signifikant von dieser hier unterschieden hat. Dort saßen sie auch an ihren Tischen, im astralen "China", und haben ihre Nudeln gegessen.
Dass dann - egal welche der 3 astralen wirklichkeiten - diese natürlich auch nicht wirklich "echt" sind, im Sinne von Sein, Existenz, das dürfte allerdings auch klar sein. Existent im Sinne von Existenz ist nur information, und diese fühlt sich halt so an, als wenn man (mit Körper) in dieser, oder eben auch in einer der 3 astralen wirklichkeiten gerade steckt, doch in gewissem Sinne sind sie allesamt gleich unwirklich, dem Traum verwandt. Insofern kommt man da als iuoc (individuated unit of consciousness, "seele", tom) nie heraus.
Bewusstheit ist nicht möglich ohne Virtualität.
Insofern auch "Existenz" und Virtualität nicht voneinander zu trennen sind.
Existiert etwas, ist es Schein.
Damit müsste dann, was nicht existiert, das Echte, das "Sein" sein.
Das klingt natürlich sehr paradox, doch das ist ja bekanntlich ein Kennzeichen, dafür, dass es wahr sein könnte. Wenn man da einfach mal genauer und konsequent logisch darüber nachdenkt, geht das auch nicht anders, oder ? So, doch jetzt nochmal dolores cannon, in besserer Audioqualität, als gestern. Hier könnt ihr von den 3-"stufigen" wirklichkeitsebenen erfahren, welche nach ihren Erkenntnissen aus Jahrzehnte langer Praxis für Normalsterbliche zur Verfügung stehen, und eben auch, wie es dort zugeht. Sozusagen die 3 möglichen Traumtheater nach diesem hier, und wie es dort halt zugeht.
Wie schon gesagt, was sie berichtet, würde ich immer abklopfen auf Effizienz, Konsistenz, möglichst aus der Sicht eines Spielebetreibers, also wie gut es angehen kann, dass es sich so verhält. Für mich ergeben sich da, wie schon gestern geschrieben, bis auf "Silberschnur" und "Schwingungslevel" wenig Kritikpunkte.
Doch einen "dicken" Kritikpunkt möchte ich anmerken, und der ist, dass sie mal von freiem Willen redet (also vor dem Game, und dann aber auch hier im Game), aber durchklingen lässt, dass das Meiste bereits festgelegt ist (durch den "Vertragsabschluß" in der "astralen" wirklichkeit). Doch ein jeder kann ja mal schauen, inwieweit sie oder er da eine Inkonsistenz sieht, oder heraushört ...
Es gibt da übrigens auch den "Grüßonkel", ("walmart Greeter", tom), dass in ein Job, den tom campbell auch mal für ~ 3 Monate in einer dieser "astralen" wirklichkeiten übernommen hat ...
Wer des Englischen nicht so mächtig ist, oder noch mehr Details erfahren will, es gibt auch ein Buch darüber seit ein paar Jahren
https://www.amazon.de/Zwischen-Leben-Aktualisierte-%C3%BCberarbeitete-Auflage/dp/1956945245


10.10.2025 n. Chr. 08.36 Uhr
Der Gedanke, dem Zufall eine Absicht unterzuschieben, ist
je
nach dem man ihn versteht, der absurdeste oder der tiefsinnigste
arthur schopenhauer (Quelle)
| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."
heisenberg, w. Zit in byrne 2012, S. 113.
|
Kurze Ergänzung zum Thema Freitod, es besteht letztlich aber
auch noch die Möglichkeit, dass eben auch dieser ein Teil des selbst zusammen
gestellten lebens ist. Bisher habe ich das zwar noch von keinem Medium, NDEler
etc. gehört, halte das aber nicht für ausgeschlossen. Jedenfalls aus der Logik
heraus spricht nichts dagegen. Es ist ein plausibler "Tod", und gut ist, Spiel
(endlich) wieder vorbei. Was mir auffällt, man kommt oft zu recht guten, mit den
(empirischen) Begebenheiten und Berichten übereinstimmenden Ergebnissen,
wenn man wirklichkeit eben nicht von hier aus betrachtet, also dem "Holodeck"
sozusagen, sondern diese wirklichkeit als Lern- und Entwicklungsumgebung
ansieht, welche dann logischerweise nicht diesseitige Bedingungen und
Implikationen mit sich bringt. Das ist, was ich glaube, mit den hermetischen
Gesetzen unter anderem, gemeint ist. Wir würden es heute anders formulieren, und
als feste oder nicht variable Programmbestandteile bezeichnen. Und dazu gehören
eben nicht nur die offensichtlichen "Naturgesetze", wie Schwerkraft etc. dazu,
sondern auch viel subtilere, versteckte Regelsätze, denen man nicht mal so eben
auf die Schliche kommt.
Schaltest du den Wasserkocher an, sollte nach einer Weile, außer er ist kaputt,
etwas passieren, nämlich das Wasser sollte kochen. Man denkt, da gibt es
Elektronen, welche durch irgendwelche Drähte flitzen, die einen höheren
Widerstand haben, sich demnach erhitzen, und somit das Wasser. Doch das ist
natürlich alles Tinneff (Blödsinn). Pulverisiert man den ganzen Wasserkocher in
Moleküle, nimmt auch die Moleküle des Wassers, und lässt in einem Experiment
diese den Doppelschlitz passieren, stellt sich heraus, es gab diese "Materie"
nie. Von Anfang an war sie information, welche sich eben tarnte, als Kunststoff,
als Metall, Draht, Schalter, Wasser, Wärme, und so weiter.
Das bedeutet dann aber natürlich im nächsten logischen Schritt, dass es etwas hinter dieser wirklichkeit liegendes sein muß, was für uns letztlich diese Illusion "Wasserkocher mit sich erhitzendem Wasser" generiert - wie dann natürlich auch allem anderen, den "eigenen" Körper, die Informationen der "Sinne", aber auch Gedanken, Gefühle (etc.) mit einbezogen. So waren zwar nicht gleich, aber doch stetig in diese Richtung meine sich entwickelnden Schlussfolgerungen, nachdem ich über das Doppelspaltexperiment gestolpert bin. Recht früh dämmerte mir, "einen Augenblick, wirklichkeit urständet dann aber nicht "hier""...

Mit der Bemühung, welche nach und nach von einem "Dämmern" zu einer Überzeugung und schließlich Gewissheit über ging, war dann stückweise sich entwickelnd auch klar, dass "hier" wirklich alles, aber auch alles völlig anders "funktionieren" muß, als eigentlich jeder gemeinhin denkt. Wie auch, dass hier alles problemlos möglich sein muß, selbst dasjenige, was man nicht einmal mehr zu denken in der Lage ist. Und - wenn man sucht - findet man auch entsprechende, ganz empirische Belege dafür.
Reichlich ...
Wenn man sich mal ernsthaftig aufmacht, ganz normale, empirische Belege dafür zu finden, dass diese uns vorliegende wirklichkeit sekundär und abgeleitet ist, demnach, wie es hier zugeht ("die Gesetze") nicht "hier" bestimmt wird, sondern "in other" (edward fredkin) - dann wird man auch reichlich ! fündig. Klar, das Sahnehäubchen, der krönende Abschluss einer langen Reise für mich ist natürlich neem karoli baba, von welchem krishna das sagt:
die Lilas fielen von ihm herab, wie Blätter von einem Baum
In Indien ist die Bedeutung "göttliches Spiel". Die "Lilas" sind den "Naturgesetzen" widersprechenden Begebenheiten, Geschehnisse, welche es nicht geben dürfte, wenn diese wirklichkeit "physisch echt" ist ...


19.10.2025 n. Chr. 08.34 Uhr
Das ist interessant, von solch einem Himmel hatte ich heute geträumt, mal astrein gradlinig verstreift, mal ein Muster wie bei tic-tac-toe, auch dass mir 2 vollständige Worte in den Himmel gemalt wurden (nur leider habe ich vergessen, was da geschrieben stand). Jedenfalls mit einem Male war der Himmel wieder ganz klar, und ich erzählte meiner Mutter davon (im Traum).
Aber es ist ja auch wieder Regen in Sicht, für morgen/übermorgen
Die Träume sind sind zur Zeit nicht wirklich mitnehmend, also emotional nicht belastend, aber nach wie vor viele viele viele. Manchmal hat man das Gefühl, man hat garnicht geschlafen, sondern nur umgeschaltet von einem in den anderen wirklichkeitsmodus.
Das Leben und die Träume sind Blätter eines und des nämlichen Buches. Wann aber die jedesmalige Lesestunde (der Tag) zu Ende und die Erholungszeit gekommen ist, so blättern wir oft noch müßig und schlagen, ohne Ordnung und Zusammenhang, bald hier, bald dort ein Blatt auf: oft ist es ein schon gelesenes, oft ein noch unbekanntes, aber immer aus dem selben Buch.
Letztendlich geht es ja garnicht wirklicher, oder echter, als dass die Bewusstheit information erhält. Mal stellt sich diese information halt dar, wie das normale leben, und ein anderes Mal als scheinbar zusammenhanglose, phantastische Episode (Traum). Vom wirklichkeitsgehalt her sind beide Zustände jedoch identisch. Daher eben auch die astralen Geschichten, NDEs, OBE's, was weiß ich, was es da noch gibt, im Kern auch nicht verschieden sind von demjenigen, was so ei jeder gerade als das "normale leben" versteht. Die jeweilige iuoc (individuated unit of consciousness, tom) erhält daten, und diese bilden dann ein astrales Geschehen ab, oder was in den NDEs geschieht, oder das "normale leben", eine OBE, oder einen Traum, was weiß ich. Im Kern, wie gesagt, sind die letztlich alle nicht verschieden.
Es gibt nur eines, was echt ist, und das ist information
Der Rest ist Illusion
tom campbell
Hat man erstmal den Paradigmenwechsel vom Aufbau von wirklichkeit vollzogen, sind solche Aussagen recht leicht zu verstehen, zumeist ergeben sie sich sogar (notwendig) als Implikation des formalen Aufbaus derselben.


26.10.2025 n. Chr. 07.22 Uhr
Meine Fresse, jede Nacht ein Traummarathon, und das nun schon seit Jahren. So ich tatsächlich noch am überlegen bin, ob ich jetzt wieder amanita muscaria sammeln gehe, oder mal für ein Jahr oder gar mehr pausiere. Denn gleich nach dem Aufwachen fühlt man sich ein wenig "geschafft". Es legt sich dann zwar recht schnell wieder, doch man hat eben nicht das Gefühl, dass der Tag "frisch" beginnt, da man schon einiges an Erfahrungen, Entscheidungen, Eindrücken gerade hinter sich hat. Aus einem freudigen Traum man im ersten Moment auch freudig aufwacht, und dann aber den Alltagstraum ("leben") als eher bedrückend empfindet, hingegen man aus einem eher schlechtem Traum, wo einem mehr als im Alltagstraum an "Schlechtem" widerfährt, man dann nach dem Aufwachen eher wieder versöhnt ist mit dem "leben" - es ja immerhin besser ist, als das gerade Erlebte.
Hier jetzt ein Kommentar unter einem Filmclip (nehme an, dass es
aus einem Film ist. So beschreibt tom campbell einen typischen NPC. Das ist
übrigens nicht der Typ von NPC, wie man sich ihn üblicherweise vorstellt. Doch
halt - wenn immer tom gefragt wird nach solch einem Typ von "Player", er ein
Beispiel ähnlicher Art bringt ("Timmy and the Well" aus Lassie)
Hier erstmal der Clip
Das ist meinem Vater passiert. Er arbeitete unter seinem
Truck, als der Wagenheber nachgab und ihn fast erdrückte. Er war allein und
konnte sich nicht befreien. Ein Mann, der gerade die Straße entlangging, war
genau im richtigen Moment zur Stelle, um ihn zu retten. Er positionierte den
Wagenheber neu und hob den Truck wieder an. Mein Vater bedankte sich bei ihm,
und er ging weiter. Mein Vater lebte seit 30 Jahren in dieser Nachbarschaft und
kannte alle in der Umgebung. Er hatte diesen Mann weder vor noch nach diesem Tag
jemals wieder gesehen.
Ja, hier ist einfach alles möglich. Wenn es noch nicht dein Tag ist, kommt halt zufällig jemand vorbei, hebt das Auto wieder an, und geht dann einfach weiter. Klar, ein Gespräch nach solch einer Art von lebensrettender Hilfe wäre das Normalste der Welt, doch würde eben an der Unschärfe zehren. Davon habe ich schon einige Erfahrungen lesen dürfen, dass ein Fremder vorbei kam, dieses oder jenes schnell machte, arrangierte, ohne (viel) zu reden, und dann wieder seinen Weges ging. Und damit halt die Unschärfe möglichst hoch bleibt, gibt es kein Gespräch. So glaube ich, dass ich einige solcher Erfahrungen "aus dem richtigen leben" hier auch schon gebracht habeOder die Wahrscheinlichkeiten
Übrigens können solche Fälle Hinweise darauf sein, dass hier tatsächlich der "objektive Zufall" (Lostrommel) am Wirken ist. Nur manchmal eben so unglücklich die Verkettung ist, dass dieser Zufall zum Ableben des Players führen würde, noch weit bevor sein angedachtes Erfahrungspaket zu Ende erleben kann. Was aber auch möglich ist, ist, dass soo etwas mit Absicht eingebaut wird in einen lebenslauf, um eben - im Rahmen "plausiblen Leugnung" - jemanden zum Nachdenken anzuregen, dass es "da draußen" nicht doch eventuell mehr gibt, als die Sinne erfahren können. Im Rahmen der "plausiblen Leugnung" (plausible Deniability/tom) meint, dass bei solch einem Vorfall die Bekannten oder Familienmitglieder immer sagen können "der war halt zufällig da", auch wenn die ganzen Umstände doch äußerst merkwürdig sind. Was ich - wie gesagt - oft gelesen habe, ist, dass solche "Helfer aus dem Nichts" meist recht wortlos agieren, und ohne einen (großen) Austausch von Worten (information !) dann einfach wieder gehen.
Mancher erinnert sich vielleicht an die Erzählung von krishna das, der Mann in der Schlange, der vor krishna das stand. Und kd irgendwas faszinierte an diesem Typ, und er sehen wollte, wie er aussieht. Wenn krishna das also rechte um die "Ecke" schaute, an den Schultern vorbei, drehte der mann seinen Kopf nach links. Als er über die linke Schulter es versuchte, drehte der Mann seinen Kopf nach rechts. Dann bezahlte dieser, drehte sich um zu krishna das, und sagte "es ist nicht in den Augen" (it's not in the Eyes"), und ging. So krishna das dann auch schnell bezahlte, und aus dem Ausgang auf die Strasse stürmte - doch der Typ war weg.
NPCs also für vielerlei Lektionen aber auch Hilfen da sein können.
Es ist nicht in den Augen ...
Vor ein paar Tagen hatte ich ja über den Freitod geschrieben, und das es ja beben "man hat sich einfach zu viel vorgenommen" bauch die Möglichkeit gibt, dass man den Freitod als ganz normale "Exit Strategie" gewählt hat, um hier plausibel wieder heraus zu kommen. Denn das kann ja keiner abstreiten, ein Freitod ist als plausible Todesmöglichkeit allgemein anerkannt. Also warum sollte man als "Lebensplan", so wie bettina es nennt, nicht solch einen "Exit" auch einbauen können oder dürfen ?
So ist sie der Profi auf diesem Gebiet, was das "geistig Empirische" (sozusagen)
angeht
Interessant, dasselbe von ihr zu hören.
Wie schon ab und an hier geschrieben, meine Einschätzungen und Annahmen ergeben sich aus der spielearchitektonischen Auffassung von wirklichkeit, und den logischen Implikationen. Also einfach gesprochen, als würde man dieses Lern- und Entwicklungsgame aus der Betreiberperspektive sehen ...


31.10.2025 n. Chr. 07.47 Uhr
Nix zu wollen. Nach 3 Tagen "Hochzwingerei", also etwas früher aus der Falle zu kommen, gab's die Retourkutsche. Fröstelnd, gähnend und mit ersten Anzeichen, dass ich krank werde, schleppte ich mich über den Tag. So geht das also nicht, die bessere Methode ist, früh in's Bett zu kommen, dann regelt sich auch das Aufwachen von allein. Die Pilzausbeute war mau, so gut wie nichts zu finden, und veranlasste mich, über die Bedingungen des Pilzwachstum ein wenig zu recherchieren, und den September wie Oktober vom Wetter her ein wenig zu rekapitulieren. Da wurde es dann klar, warum so gut wie überhaupt keine Pilze zu finden sind (hier), der September war bis zum 21sten zwar warm, aber zu trocken, und mit einem Schlag kam dann der Herbst, dieser wiederum zwar nass, aber zu kühl. Feuchtigkeit und Wärme macht Pilze, beides gab es aber die letzten 2-3 Monate nicht im Verbund. Sogar von den Parasolen habe ich im Juni mehr gesehen, als jetzt, wo doch Piltzsaison ist. Auf diese 2-3 Tage warte ich jetzt, nachts noch um die 10°C, Nässe und einen Tag 18°C, um dann ~ 7 Tage später nochmal in den Wald zu gehen.
Gestern Abend bei einem kleinen Spaziergang kam es mir wieder in den virtuellen Kopf, wie "am Ende", wie beinahe gänzlich ausgehölt doch die menschen sind, jedenfalls im Westen. Hier das Bild der Szene aus "i pet goat 2" dazu ...
Tabletten, eine Nadel ...
Details in jeder 10tel Sekunde ...
So beginnt ja der Film, wenn man sich eine Hausziege hält ...
Das hat dann auch Konsequenzen. So ist ja auch der Brand von Notre Dame, und der gesamte Fall der Turmspitze bis in's Detail des Fallens ! 10 ? Jahre vorher schon in diesem Kurzfilm festgehalten, was uns sagt, dass hier "wirklichkeit selbst" die Finger im Spiel hat.
Wer nachforscht nach dem "Producer" Heliofant, landet in der beinahe vollkommenen Unschärfe. Genau so, wie bei den Investmentfond, welchem alles über Fonds Kaufbare gehört (also auch alle anderen Fonds), nämlich Vanguard, wenn man dort bei den Börseninformationsdiensten recherchiert, wer die Anteilseigner sind, steht dort nur; privat.
"Privare" ist ein lateinischer und italienischer Begriff, der
„berauben“, „entziehen“ oder „vorenthalten“ [Unschärfe ...] bedeutet. Er wird im Deutschen als
Teil des Begriffs "Deprivation" verwendet, was den Zustand des beraubt oder
entbehrt sein beschreibt. "Privare" und "berauben" sind daher eng verwandt,
wobei "privare" das lateinische bzw. italienische Wort ist.
Also, wenn man einfach hartnäckig bleibt, dann ist schon zu merken, dass dieses Videogame hier zwar erstmal, und auch auf den zweiten, den dritten blick "physisch" plausibel ist, und bleibt, doch wenn man weiter nachhakt, so allmählig die "physische" Plausibilität verliert. Man muß aber auch wohl annehmen, dass "das Spiel selbst" oder "wirklichkeit selbst" von sich aus Hinweise liefert, welche allerdings so versteckt, verpackt sind, dass man schon sehen können muß, um es zu sehen. Hier greift das Prinzip der "plausible Deniability", wie tom campbell es nennt. Also bis zum meinetwegen 5ten Blick ist es noch "physisch" "erklärbar", aber demjenigen, welche dann in der Lage oder hartnäckig genug ist, nochmals einen tieferen Blick auf das Ganze zu werfen (Logik ist hier auch von Nöten), eröffnet sich dann: es kann nicht physisch sein.
kann nicht = transcendentales Moment (immanuel kant)
D.h. Die Bedingungen der Möglichkeit, dass dieses oder jenes auf "physischem" Wege möglich ist, sind nicht mehr gegeben (kann nicht), daher das Ganze auch nicht physisch sein kann. Ein schönes Beispiel:
|
Die Ontologie des Materialismus beruhte auf der Illusion, dass man die Art der Existenz, das unmittelbar Faktische der uns umgebenden Welt, auf die Verhältnisse im atomaren Bereich extrapolieren könne.
werner heisenberg, hier auf der
Solvay-Konferenz 1927 |
Das Prinzip der "plausible Deniability" (plausible Leugnung) regelt, dass derjenige, welcher halt nicht hartnäckig sich hinein vertieft (Freigabe, Schwellenwertprinzip), Gründe und "Fakten" geliefert bekommt (Wikipedia, (Schein-)"Wissenschaft" etc.), dass er es hier mit einer materiellen, physischen wirklichkeit zu tun hat. Und das - wie gesagt - auch noch auf den zweiten, dritten Blick. Nehmen wir uns als ein Beispiel dieses Prinzips der "plausible deniability" DAS Experiment schlechthin, das Doppelspaltexperiment. Stell dir vor, du hörst zum ersten Male davon, dass dieses so außergewöhnlich sei, und frappierende Implikationen in sich trägt (oder besser: erstmal in sich tragen soll), und beginnst, dich zu informieren.
Im Prinzip hast du so gut wie keine Chance, auf den springenden Punkt dieses
Experimentes zu kommen. Du wirst zugeschissen mit Sozialismus, wohin du dich
auch wendest, und wenn dein logisches Vermögen vielleicht zwar vorhanden, aber
nicht gut trainiert ist, wirst du diesen "springenden Punkt" nie erkennen, er
wird dir nicht frei geschaltet. Warum ? Nun, Hartnäckigkeit, du bist noch nicht
einmal über den ersten Blick hinaus gekommen, ergo: deine Welt bleibt physisch.
Aber auch der 2te und dritte Blick ist nicht viel besser, da die Sophistikation
zunimmt, maßgeschneidert auf deine gegenwärtige logische Kapazität, und du wirst
wieder überzeugt werden:
hier ist nichts zu sehen, gehen sie weiter.
Sogar wolfgang, immerhin ein Dr. der Mathematik, hat wohl ein halbes Jahr gebraucht (ich habe ihm immer wieder verschiedene Ansätze der Betrachtung geschickt), bis er mir dann irgendwann schrub, "jetzt hat es "Klick" gemacht".


01.11.2025 n. Chr. 07.22 Uhr
Das ist der richtige Weg, 22m40 Uhr in die Falle, und immerhin 07.10 Uhr einigermaßen erholt aufgewacht, ohne das Gefühl, sich nochmal umdrehen zu wollen. Gestern mit jens kurz telefoniert, welcher einen ähnlichen lebensweg wie ich hat, als auch schon als kind mit dem Gefühl "irgendwas stimmt hier nicht, es ist nicht so, wie es scheint" ausgestattet war, und auch die erforderlichen Qualitäten mit sich brachte, der Sache (hier) auf den Grund zu gehen. So fragte er mich denn gestern, wie ich es mir erkläre, dass hier nicht viel mehr "Glitches", also Fehler passieren, und exakt diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Und ich habe da letztlich (erstmal) nur eine Erklärung dafür, nämlich, dass die daten, welche etwa uns fühlen lassen, dass wir grad am Tisch sitzen, die Sonne geht auf, der Blog wird geschrieben, der Taubneesseltee ist fertig ... etc., vorher einmal einer Prüfung unterzogen ("Prüfsumme"), bevor sie "abgeschickt" werden.

Dass wirklichkeit datenbasiert ist, daran ist ja schon seit längerem, also ~100 Jahren, nicht mehr zu rütteln, doch eben die Perfektion der Imitation einer "physischen wirklichkeit" lässt schon enorm Staunen.

Obwohl man sagen muß - wir haben ja die Träume, und diese mußten uns aufhorchen lassen, denn im Traum denken wir ja auch, dass alles (physisch) echt ist. reden mit menschen, machen, tun, erleben, nicht wirklich anders, als in der "Tagesbewusstheit".
Überhaupt mag der Augenblick des Sterbens dem des Erwachens
aus einem schweren, alpgedrückten Traum ähnlich sein
arthur schopenhauer
Zahlreiche Zitate es ja von großen Denkern, Dichtern und (spirituellen) Lehrern gibt, welche mehr oder minder das "leben" und den "traum" geich setzen, also letztlich vom Kern her, also was Bewusstheit geschieht, auf eine Stufe stellen. Heute wissen wir, dass sie richtig lagen, nur damals, oder gar vor ein paar tausend Jahren, war das objektiv nicht zu untermauern. Heute schon.
In seiner Autobiografie beschreibt Wheeler,
wie er nacheinander von drei metaphysischen Ideen erfasst wurde: Alles ist
Teilchen, alles ist Felder und schließlich, am Ende seiner Karriere, alles ist
Information. Zu dieser letzten Idee schrieb Wheeler: „Je mehr ich über das
Geheimnis der Quantenphysik und unsere seltsame Fähigkeit, die Welt, in der wir
leben, zu verstehen, nachgedacht habe, desto mehr sehe ich mögliche grundlegende
Rollen für Logik und Information als Fundament der physikalischen Theorie.“
*William Dembski*, „How Informational Realism Dissolves the Mind–Body
Problem“ (Wie der Informationsrealismus das Leib-Seele-Problem auflöst) in /Mind
and Matter: Modern Dualism, Idealism and the Empirical Sciences (Geist und
Materie: Moderner Dualismus, Idealismus und die empirischen Wissenschaften)
Eine NDE, OBE oder ähnliches hilft da auch nicht, objektiv die Verwandtheit von leben und Traum zu untermauern. Doch remote viewing, Telepathie und Ähnliches schon. Bei den Urvölkern sollen solche Fähigkeiten noch immer vorhanden sein, früher natürlich weitaus mehr ein ganz normaler Teil des Alltagslebens, und da wir es bei solchen Geschichten mit objektivierbaren Erlebnissen, Geschehen zu tun haben, kann man von dort aus schon recht leicht zu dem Schluß kommen, dass wir es hier mit einer Simulation zu tun haben, wiewohl man früher wohl als beste Analogie oder Metapher den "Traum" als Vergleich wird heran gezogen haben. Oder eben auch Theater (sofern es das schon gab).
Die ganze Welt ist eine Bühne, und alle Männer und Frauen sind bloße Schauspieler
shakespeare
Gestern Abend beim zu Bett Gehen fiel mir ein, ob nicht überhaupt "in Bewusstheit sein" (scheißegal in was für einer wirklichkeit/datenstrom) nicht schon an und für sich irgendwie anstrengend ist. Also überhaupt Bewusstheit zu erleben, egal in welcher Form. Man prozessiert ja daten, und grundsätzlich ist das ja bereits schon eine Arbeitsleistung. Also
Bewusstheit an sich ist bereits Arbeit.
Dann wird auch die Metapher mit dem "Brennen" besser klar. In den tiefen alten Lehren wird gesagt, dass du nicht nur brennst, wenn du starke emotionale, Ego-Verhaftete Zustände erlebst (man sagt ja: "burning Karma"), sondern die ganz gewöhnlichen Sinne schon das Brennen bedeuten. Die brennst, wenn du siehst, hörst, schmeckst, riechst, ganz egal, was du siehst, hörst, schmeckst, riechst - es ist eine grundlegende Arbeitsleistung, welche du vollführst, das ist eben bereits "das Brennen", egal, was nun der Inhalt sein mag. Also bereits überhaupt "in Bewusstheit zu stecken" schon auf gewisse Art anstrengend ist. Doch wenn Bewusstheit als Arbeitsleistung angesehen werden kann, dann ist es schon angebracht, es so zu betrachten, unerheblich, mit was nun inhaltlich die Bewusstheit gefüllt wird. Auch wenn der Vergleich etwas hinkt, ein DVD-Player verbraucht dieselbe Energie, egal ob er nun einen Horrorfilm oder eine Schnulze abspielt.
Damit Bewusstheit diese Arbeitsleistung nicht zur Bürde wird, ist es natürlich gut, wenn man etwas will (Neigung, Charakter), jetzt fällt es einem auf einmal sehr leicht, man bemerkt die Arbeit garnicht. Wie gut kennen wir das aus unserem leben, du bist voll vertieft in eine Sache, weil du richtig "Bock drauf hast", und bemerkst garnicht die Zeit, welche vergeht, während du an diesem oder jenem kniffelst und knobelst.
Das - wie gesagt - fiel mir gestern Abend ein, bereits in Bewusstheit selbst zu stecken (noch vor jedem Inhalt) ist im Grunde bereits anstrengend, oder jedenfalls eine Form von Arbeit. Dass man so viele antrifft, welche sagen, dass sie bloß nicht wieder geboren werden wollen, kann mit diesem Punkt zusammen hängen. Wie viele gibt es, die sich trotz Berühmtheit und eines Luxus-lebens dasselbe nehmen, einfach, weil ihnen vielleicht dieser Umstand selbst auf den Keks ging, immer wieder in Bewusstheit zu sein ?
Nicht umsonst dieses "mal Abschalten" Moment mit Meditation, Yoga, was weiß ich, sich im Westen so breit gemacht hat. Die menschen bekommen einfach die Grenzen mit, wie es ist, dauernd in Bewusstheit zu stecken, und wie anstrengend das doch ist. Manche haben (ohne es zu wissen) vielleicht das Glück, dass sie zwischendurch mal "abschalten", und so die Belastung nicht merklich als Arbeitsleistung wahrgenommen wird. In Indien es aber schon wohl ein paar tausend Jahre gelebt wird, von vielen, das bewusste Abschalten von Bewusstheit, vielleicht, weil sie irgendwann gemerkt haben, dass das Bewusstheit an sich irgendwie schon eine Arbeitsleistung, und demgemäß auch mal Erholung von Bewusstheit einzufordern ist ?
Nirwana, Samadhi etc. als "Urlaub" von Bewusstheit ?


02.11.2025 n. Chr. 07.39 Uhr
the higher states of consciousness can not be achieved by
your personal will power
Die höheren Bewusstheitszustände können nicht durch deine
eigene Willenskraft erreicht werden.
neem karoli baba (link)
Etwas meinungslos, da passt es gut, dass es wieder ein Interview mit tom gibt. Der Interviewer arbeitet als Lehrer im Monroe-Institut, was den ganzen Interview eine eine Note verleiht, da ja tom mit robert monroe eng zusammengearbeitet hatte über Jahre. Der bledsoe redet für meine Begriffe zwar manchmal etwas "ungewaschenes Zeugs", wie schopenhauer es formulieren würde, doch alles in allem dennoch hörenswert !
Das Grau da draußen macht es auch nicht besser, relativ exakt ist das ja seit dem 21. September schon so, doch heute geht es mir irgendwie auf den Keks. Also gleich mal für 90 Minuten Spazieren gehen, immerhin ist es nicht kalt, stürmt nicht, und Regen ist auch nicht in Sicht.
Irgendwann demnächst möchte ich auch mal (wieder) etwas "Fun" haben, und diese Nasa-Videos mit ihren Glitches, Versprechern, freemason Handshakes und Ungereimtheiten mal auf die Schippe nehmen, und aus spielearchitektonischer Perspektive kommentieren. Der Mainstreamer, wie der Truther werden nämlich an der Nase herumgeführt, denn das Konzept "Raum" wird ja, auf die eine oder andere Art, bei beiden Fraktionen verfestigt. Womit das Ziel erreicht ist. Auch "Raumschiffe" und "Aliens" zählen dort natürlich mit hinein. Hier und da mal eingeflochten, bleibt das Konzept Raum, "Universum" und so weiter, in den virtuellen Köpfen der menschen fest etabliert. Das hat tom auch im letzten "incoming" Interview angemerkt, dass eben "Aliens" und "Raumschiffe" hier immer mal eingeflochten werden können von der lcs. Wobei allerdings tom sagt, dass es dann dazu ist, um den Horizont der menschen mal etwas zu erweitern, also das es "mehr gibt". Kann angehen, denn für viele menschen wäre eine willkommene Ablenkung, mal den Blick von diesem tristen Einheitsbrei abwenden zu können, doch grundsätzlich bleibe ich dabei - am langen Ende wird der Glaube an die Echtheit des Theaters hier durch solche Einschübe verfestigt.
Klar, die "Aliens" können auch eingeflochten werden als Lösung für Probleme der Effizienz der Simulation hier, welche auf anderem Wege plausibel und ohne den freien Willen umzuschreiben, nicht mehr gegeben sind. Dann müssen's halt "die Aliens richten". Doch das wäre dann mehr oder minder die "ultima Ratio", also wenn wirklich nichts anderes mehr plausibel zu implementieren ist. Grundsätzlich hat sich ja die menschheit schon seit einer Weile ziemlich festgefahren, und dazu noch in einer Sackgasse, doch wann es der lcs "zu dicke" wird, weiß ja keiner von uns. So tom nur meint, dass es tatsächlich soweit kommen kann, und dann gott sich halt selbst in's spiel einmischt. Doch meiner Logik nach wird diese Einmischung dann so subtil sein, dass es nahezu keiner bemerkt, dass hier in großem Stile "höhere Kräfte" sich einmischen. Man muss bedenken, dass ja auch die Geschichtsbücher von morgen immer mit einer ("physischen") Plausibilität aufwarten müssen.
So würde es mich natürlich auch freuen, wenn sich hier außer dem Üblichen "immer irrer" mal irgendwas anderes auf der Bühne aufgeführt werden würde, doch das Stück mit dem gefühlt ewig gleichem Inhalt will einfach nicht zu Ende gehen. Doch damit freunde ich mich Jahr zu Jahr ein wenig mehr an, dass sich das auch nicht ändern wird, demgemäß es für die geistige Gesundheit eine gute Empfehlung ist, sich abzuwenden. Wie jiddu es meinte
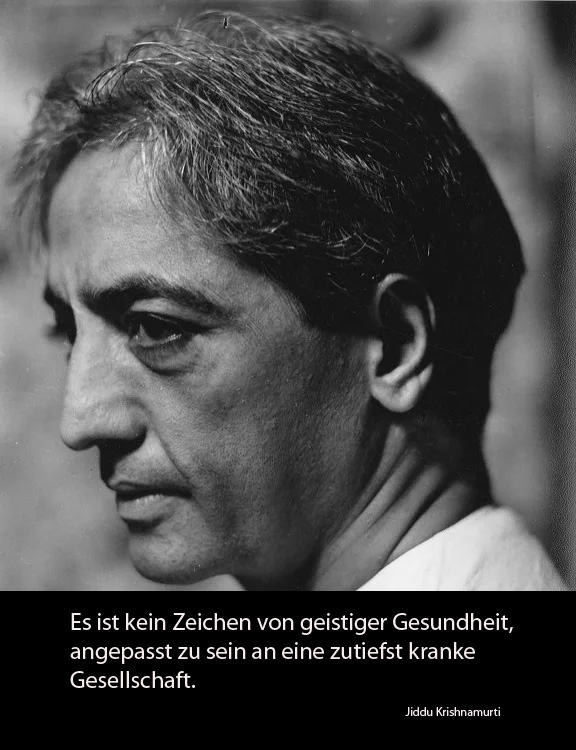
Wozu natürlich auch die "Trutherszene" gehört, welche zwar in einem anderen Abteil sich befindet, doch in dem gleichen Zug. Nichtsdestotrotz ich mich auch nicht davon ganz abkoppeln kann, manchmal ist es auch regelrecht amüsant, wenn man dann zu sich sagt, "das kannste dir nicht ausdenken ...".
it from bit


04.11.2025 n. Chr. 07.26 Uhr
Allerdings schon seit 6 Uhr wach, gegrübelt, nachgedacht, mir
macht das ja Spaß. Das mag auch einer der Gründe sein, warum ich einfach nicht
"zu zweit" im Bett aufwachen wollte, weil ich es nicht brauchen kann, grad
aufzuwachen, und dann von der Seite angequatscht zu werden mit "guten Morgen
Schatzi", oder sonstwas ...
Meine Meinungslosigkeit hält an, vielleicht ist es aber noch immer dieses
"Plateau", von welchem ich schon vor etwa 2 Jahren geschrieben habe, welches man
erreicht hat. Also die Erkenntnis, dass - wie auch immer es ist - alles in
der richtigen Ordnung, oder, wie es maharaji ji ausdrückt, perfekt ist.
Was mich mal ein wenig "getroffen" hat, wie ein kleiner Blitzschlag, war der Satz (anlässlich einer großen Schlacht o.ä.):
sie sind doch schon alle tot.
Was dann ja auch impliziert, dass man niemanden (wirklich) umbringen kann. Und aus der hinduistischen, buddhistischen, wie spielearchitektonischen Betrachtung des Theaterstückes hier, ist es auch so. Die Akteure (die Klamotten, die Rolle) "leben" als solche nicht, sie sind Fiktion.
ram dass zu krishna das:
"we are all Fakes"
krishna das zu ram das:
"yes, but we are the real Fakes"
Die Akteure auf der Bühne werfen dann in der Umkleide ihre Klamotten ab, und dann sind sie wieder sie selbst, um die Erfahrung eines vielleicht gut gespielten Stückes reicher.
Auf und durch die Bühne reift man.
Nicht Backstage.
Auf der Bühne stirbt man auch.
Aber eben nicht: Backstage
Und so ist halt wirklichkeit (die Bühne), wie sie ist. Für die einen stellt sie sich als materialistisches Schlaraffenland dar, für die anderen als willkommene Gelegenheit einfach nur still zu sein, und in sich zu gehen. Dann gibt es dazwischen den großen Batzen, welche in dem Streben "mehr Materie" zumeist ihr ganzes leben verbringen, wenn sie nicht das Glück haben, dass eine Form von Altersweisheit sie dann doch noch ereilt.
Im Allgemeinen der Sozialismus, satan oder wie man das auch immer nennen möchte ja als "Verführung", als Versuchung angesehen wird. Im Wesentlichen als das Reizende, Lockende, Angenehme.
Was ist dein Preis ?
Das habe ich früher oft geschrieben, satan kommt als kecke Blondine, Status, als Fußbodenheizung, Couch, Anerkennung, einfach dem (scheinbar) Angenehmen, Schmeichelndem, (Ver-) Lockendem. Wenn man herausfinden möchte, ob etwas Lockendes etwas Verlockendes ist, muß man nur darauf achten, ob es am langen ! Ende zu mehr Kontemplation oder zu mehr Abgelenktheit führt. Wenn es einen irgendwo hinzieht, ist es also nicht per se falsch.
Und im logischen Sinne "falsch" ist sowieso niemals irgendwas. Weil die Dinge so sind, wie sie sind, werden sie, wie sie werden.
Oder genauer: weil die Dinge so sind, wie sie sind, werden sie - im Rahme der Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten - wie sie werden.
Denn beides isoliert geht nicht:
100% Zufall`= nicht kann existieren (datum/information für
Bewusstheit sein)
100% Determinismus = es kann zwar "was" existierten (ist ja auch implizit
im Begriff enthalten), aber nichts kann je voran kommen. Wenn alles beständig
auf dem Fleck steht, ist das auch nichts anderes, als wenn nichts ist.
Irgendeine Form von Konsistenz benötigt jegliche
wirklichkeit,
soll sie als solche in Bewusstheit interpretierbar sein
So eben selbst unsere Träume, so wirr sie auch sein mögen, noch immer irgendwie Konsistenz aufweisen, und sei es auch nur für eine kurze Spanne. Ohne diese wären "die daten" kein Gegenstand einer Interpretation, es spänne sich nicht so etwas wie eine "wirklichkeit" auf. Im Grunde - da wir eine sehr lebendige, vielfältige wirklichkeit vor uns haben (natur), können wir auch damit sofort sagen, dass sie nicht materiell sein kann. Den wäre sie es - es könnte sie nicht geben. Das ist wohl das einfachste Argument, welche man - auch ganz ohne DSE - gegen den Materialismus und Determinismus zu Felde führen kann. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich der Materialismus von ganz allein ad absurdum führt, sich damit also selbst widerlegt. Man muß in nur konsequent ! zu Ende denken.
So, nun ist die Bühne ("Welt") halt grad so, wie sie ist, und es sieht so aus,
dass wir auf irgendeine Art gehalten sind, Teil zu nehmen. Auf dem Holodeck ja
auch mal im wilden Westen, mal im Mittelalter, was weiß ich, sinnvoll irgendwas
machen, reagieren, interpretieren kannste nicht, wenn du bloß einen
formal-digitalen "Raum" um dich herum hast.

Aktuell ist es Grad nicht Zirkus Mittelalter oder Zirkus wilder Westen, sondern Zirkus "new world order" (novus ordo seclorum), so wird dieser Spielelevel wahrscheinlich verzeichnet sein. Wobei die Plausibilitäten dafür ganz klar in Richtung "Okkultismus", und gewisse "Organisationen" weisen. Doch das ist halt nur Smokescreen, um im Rahmen des "PSI Unschärfe Prinzips" zu bleiben, wie tom es ausdrücken würde, Diese Organisationen, Playergruppen sollen auch glauben, dass sie es sind, welche hier die Bühne bestellen. So ist das Spiel beschaffen, so funktioniert Plausibilität. Passieren "hier" Dinge, müssen auch die Plausibilitäten dafür "hier" (scheinbar) zu finden sein.
Denn wir sind wie Baumstämme im Schnee. Scheinbar liegen sie
glatt auf, und mit kleinem Anstoß sollte man sie wegschieben können. Nein, das
kann man nicht, denn sie sind fest mit dem Boden verbunden. Aber sieh, sogar das
ist nur scheinbar.
franz kafka, die Bäume


05.11.2025 n. Chr. 08.07 Uhr
Glück gehabt, ich dachte ein ziemlich mitnehmender Traum werde der letzte vor dem Aufwachen sein, was immer ein wenig blöd ist, da man die Stimmung noch eine Weile in den Tag trägt, doch 2 weitere schlossen sich noch an, und verwischten die emotionale "Tiefe" des nun "drittletzten". Wiewohl ich mich an den Inhalt noch erinnern kann, ist aber der gefühlsmäßige "Nachhall" nicht mehr vorhanden.
Gestern kam ich auf diesen einfach Gedanken, nämlich "wäre die wirklichkeit materiell, sie könnte nicht sein".
kann nicht
Mit dem "kann nicht" sind wir in einem transzendentalen, logischem Raum, noch vor aller Erfahrung, und haben es mit den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung überhaupt zu tun. §es kann nicht sein, dass ein Gegenstand, welcher sich bewegt, und welchen nichts ! in seiner Bewegung beeinträchtigt, langsamer wird". Da steckt dann das "Gesetz der Massenträgheit", "Energieerhaltungssatz" und noch so einiges mehr mit drin, obwohl ! eben dieser Satz vor der Erfahrung, vor aller Erfahrung gilt. Oder jedenfalls erst einmal scheinbar gilt, denn natürlich kann ein sich bewegendes Etwas auch ganz ohne irgendeinen Einfluss von Außen oder Innen mit einem Male langsamer werden oder stoppen, denn wir befinden uns hier ja in einem "Videogame", mal salopp gesagt, und was dort möglich ist, ist hier allemal möglich.
Unser denken also, siehe "Massenträgheit", ist bereits trügerischerweise in Grund und Folge, Ursache und Wirkung angelegt, also in Kausalität. Und das ganz in der Tiefe. Was noch dazu kommt, wir vermischen Kausalität und Logik, "wenn es Grund und Folge hat, Ursache und Wirkung", dann ist es logisch. Das funktioniert auch ganz gut auf den oberflächlichen, den ersten oder zweiten Blick ("Wissenschasften") doch wenn sich die Logik von dem kausalen Denken befreit, und sich mal auf eigene Faust aufmacht, tauchen schnell Ungereimtheiten auf. Dieses was jetzt kommt, hatte ich wohl mal irgendwann mit ~ 14 Jahren irgendwo gehört, und es hat mich damals am Campingplatz, außen auf dem Weg am Waldrand, zurück zum Wohnwagen, immer beschäftigt "irgendwas stimmt mit der Zeit nicht". Denn ist sie ein Kontinuum, und unendlich teilbar (also nicht diskret, getaktet, wie wir heute wissen (planck-Zeit)), kann der Pfeil nicht fliegen, kann Achilles, der schnellste damalige Läufer, die Schildkröte nicht einholen. Das hat mich wirklich lang beschäftigt, und konnte es nicht auflösen. Der Pfeil kann nicht fliegen (unter der Annahme von Zeit und Raum als Kontinua), und doch bewegt sich überhaupt alles, wie geht das ?
So zenon folgendes verdeutlicht, sind Zeit und Raum Kontinua, sind sie auch in der kleinsten Größe unendlich noch bestehend aus "Zeitlichkeiten" und "Räumlichkeiten", doch wie soll da etwas "Endliches", die gedachte Materie, sich dort durch bewegen ?
Hier in diesem Paradoxon wird nicht mehr, als die Idee der Zeit angewendet, wie sie jeder in sich trägt.
ich bin in 2 Minuten da
ich bin in 20 Minuten da
ich bin in 2 Stunden da
Unsere Zeitauffassung ist die der Kontinuität (erstmal)
Video über achilles und die Schildkröte
Damals als Kiddie hab' ich mich lange damit herumgetragen, dass bei der Annahme, dass Zeit und Raum Kontinua sind unsere wirklichkeit nicht so funktionieren könnte, wie sie zu funktionieren scheint. Rein logisch betrachtet würde es dann wirklichkeit nicht geben können, wie sie sich uns zeigt, also hätte man rein logisch schon vielleicht vor tausenden von Jahren darauf kommen können, dass die Zeit getaktet ist (wie bei einem Computer), wie, dass der Raum selber gepixelt sein muß, wie beim Monitor, Bildschirm etc.. Heute wissen wir das, planck-Zeit und Länge, doch man hätte, mal streng logisch betrachtet, zur "Quantenmechanik", also der Theorie oder Wissenschaft des Diskreten (was dann nicht mehr im Raum befindliche Materie sein kann) schon vor ein paar tausend Jahren kommen können.
wäre wirklichkeit materiell, sie könnte nicht sein.
Selbst ohne NDE, DSE, OBE, bruno gröning, roland plocher oder neem karoli baba, um nur einige zu nennen, hätte man im Prinzip schon viel weiter in der Erkenntnis sein können, wäre man rein bei der Logik geblieben, und hätte diese eben nicht mit der "Logik des Materiellen" (Kausalität) vermischt. Demnach zenon also genau auf dem richtigen Weg war !
|
Die Ontologie des Materialismus beruhte auf der Illusion, dass man die Art der Existenz, das unmittelbar Faktische der uns umgebenden Welt, auf die Verhältnisse im atomaren Bereich extrapolieren könne. werner heisenberg |
In dem "unglaublich guten" Marseille-Workshops arbeitet auch tom campbell dieses Problem (u.a.) auf, also was es mit sich bringt an Ungereimtheiten, wenn man Raum und Zeit als Kontinuum annimmt, und zitiert auch diesbezüglich einstein (ein Brief von ihm an max born oder bohr), dass man von der Auffassung von Raum und Zeit als Kontinua weg müsse (um das DSE erklären zu können ?), er jedoch nicht die geringste Idee hat, wie das gehen sollte.
Playlist tom campbell marseille Workshops
Hätte hätte Fahrradkette ... wie man sagt, doch wäre man auch vor tausenden von Jahren einfach streng logisch geblieben, siehe zenon, wäre schnell klar gewesen, dass wirklichkeit diskret, und damit digital ! aufgebaut sein muss. Damit wäre dann aber auch klar, dass die Idee von Masse eine Illusion sein muß, da das "Materielle" als solches es
nicht
geben
kann
Darauf hätte (ja, ich weiß ...), man schon vor langer Zeit drauf kommen können. Immerhin, franzi und mir wurde die fehlende Massenträgheit bei einem riesigen Objekt, welches ja etwas wiegen sollte, nämlich dem Mond, auch ganz unverblümt gezeigt, als er sich eben digital, ruckelnd und zuckelnd durch den digitalen "Raum" bewegte. Doch wie gesagt, wäre man rein bei der Logik geblieben, man heute schon viel viel weiter sein können, heute. Noch ganz ohne NDE, OBE, Samadhi, roland plocher, therese neumann, mirin dajo oder selbst neem karoli baba. Die "Wunder" und das absolut Ungewöhnliche wären beinahe eingepreist in dieses streng logische Bild von wirklichkeit.
im anfang war der logos
und der logos war bei gott
und gott war der logos
Soweit beginnt es bei johannes, und der war nicht irgendwer ...


07.11.2025 n. Chr. 08.09 Uhr
Der Realismus, der sich dem rohen Verstande dadurch
empfiehlt, daß er sich das Ansehn giebt
thatsächlich zu seyn, geht gerade von einer willkürlichen Annahme aus und
ist mithin ein windiges Luftgebäude, indem er die allererste Thatsache
überspringt oder verleugnet,
diese, daß Alles was wir kennen innerhalb des Bewußtseyns liegt.
arthur schopenhauer
Solch ein schöner Anblick um diese Zeit, schon seit 3 Tagen. Vorgestern, als es noch "richtig warm" war über den Tag, blieb der Computer bis 19 Uhr ausgeschaltet, es war einfach genug draußen zu "erledigen". Das Handy nutze ich ja für Kurzweil nicht, weil mir das einfach zu blöd ist, mit diesem Mini-Bildschirm. Dern Ashram oben, welcher ja nun mit einer 80er Deckendämmung versehen ist, habe ich erstmal mit einem Hygrometer versehen, und einen Sensor oben an der Decke platziert, um die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten.
Jedenfalls ist es jetzt so, auch natürlich dank des sehr effizienten Kamins, dass man mit einem Stückchen Holz, 5x5x20cm etwa 250-25 Minuten auskommt, um auch bei 5°C draußen die Temperatur drinnen sogar noch zu steigern, so 0,1°C/5 Min.. Das Feuer ist wirklich auf "Sparflamme", und es wird dennoch stets nur wärmer.
Die Temperaturen um Abgasrohr (Ofenrohr) betragen am Ausgang direkt am offen 65-100°C, und am Wandanschluß, nach ~ 2 Metern und 2x90° Bögen, sind es noch 35-60°C.
Die ganze Geschichte ist äußerst effizient, jedenfalls respektive zur vorherigen Situation mit dem alten Ofen und ohne Dämmung. Doch habe ich mich aus Gründen der Vorsicht dann doch gestern entschlossen, eine Dampfsperrbahn anzubringen. Habe länger gesucht, weil es eine Aluminium-Bahn sein sollte, welche aber kaschiert ist mit einem Material, welches sich mit Styropor-Kleber verbinden kann. Da scheidet ja Alu selbst aus, Polyethylen und ähnliches auch, und bin dann gestern auf einen Hersteller aus Finnland gestoßen, welcher eine Dampfsperre aus Aluminium anbietet, die mit Papier beschichtet ist, welches sich gut mit dem Styroporkleber verbinden sollte.
Nach meinen überschlägigen Recherchen sollte sich zwar auch ohne Dampfsperre kein Schimmel hinter meiner Styropor-Isolierung bilden, doch dachte ich mir, dass nach dem ganzen Aufwand und Sauerei (mit dem Kleber, welcher ja hie und da runterfällt von der Kelle) es jetzt auch nichts mehr ausmacht, dass ich die Decke noch flugs mit dieser Dampfsperre ausstatte. Die Folie reflektiert ja auch nochmal IR-Strahlung. Ob das in der Praxis dann bemerkbar sein wird, dürfte allerdings zweifelhaft sein. Soviel zum Ashram.
´Wäre wirklichkeit "materiell", sie könnte nicht sein.
Noch einmal zurück zu dieser einfachen Feststellung, welche mir
vor ein paar Tagen durch den virtuellen Kopf schoß. So glaube ich, dass es
vorgestern war, während eines Spazierganges, dass ich - so glaube ich - in die
Nähe des Kardinalfehlers kam, welche wir beim Denken begehen, wenn wir Aussagen
über (die natur von) wirklichkeit tätigen. Und der besteht darin, dass wir, ohne
Evidenz dafür zu haben, eine dingliche Existenz von auch nur irgendwas
außerhalb, respektive auch ohne unsere Bewusstheit annehmen. Ist "da draußen"
etwas Dingliches, auch ohne unsere Bewusstheit, hat es seine eigenen,
dinglichen, materiellen, kausalen Regeln, und das haben wir dann in das Kleid
der "Wissenschaft", ihrer Disziplinen und "Gesetze" gegossen - sehr voreilig.
Nur sehr wenigen ist es aufgefallen, dass das rein logisch nicht geht. Wir
können keine Brücke schlagen von einem Datum für unsere Bewusstheit (das Auto,
die Rose, das Taschentuch ...), dass diese Information dann nochmal "an
und für sich", auch außerhalb unserer Bewusstheit "existiert". Das geht logisch
nicht, man kann diese Brücke nicht schlagen. Und die paar, denen das aufgefallen
ist, waren plato, leibnitz (zu 50%/Monadologie),
kant und schopenhauer. Heute letztere mehr im
Fokus stehen, denn je (dank auch des
DSE, der Quantenmechanik). "Zufällig" hatte ich gerade diese 4 Idealisten
ausgiebig studiert, über 7 Jahre, bevor es dann mit den Motorrädern begann ...
| "ich glaube, ein wichtiger Punkt, warum in Deutschland unsere Bücher so populär sind, liegt darin, dass sich unsere Diskussionen dem Idealismus nähern, beziehungsweise, dass wir uns analytisch, metaphysisch, objektiv und ontologisch mit einigen der reichsten Traditionen des deutschen Idealismus treffen, mit schopenhauer und anderen brillanten Denkern, die an dieser wahrheit dran waren. Ein Großteil ihrer Arbeit tritt mit dieser wissenschaftlichen Revolution in ein neues Licht ..."
eben alexander
|
Bis auf wenige Ausnahmen, ist es kaum einem menschen aufgefallen, dass es letztlich nicht geht, der wirklichkeit ein materielles Fundament unterzujubeln. Die Logik gibt das nicht her, auich wenn es tausendmal so scheint, als ob. Schließlich und endlich jetzt plato, kant und schopenhauer Recht behalten sollten. Allerdings schopenhauer auch noch locke, hobbes und hume erwähnt, die englischen Sensualisten, welche die Sinne in das Subjekt geholt haben. Und kant dann zum letzten großen Rundumschlag ausgeholt hatte, und eben auch Zeit und Raum in das Subjekt holte, also dass diese subjektiv sind, und nun mit einem Male diese "Welt da draußen" verschwunden war. Sie war: Illusion. Oder sagen wir mal so - musste eine Illusion sein, hartnäckig und streng logisch betrachtet. So hat schopenhauer das immer so beschrieben, das Zeit und Raum wie geschliffene Brillengläser einer Brille sind, welche wir aufhaben, jedoch nicht bemerken, dass wir diese Brille auf der Nase sitzen haben.
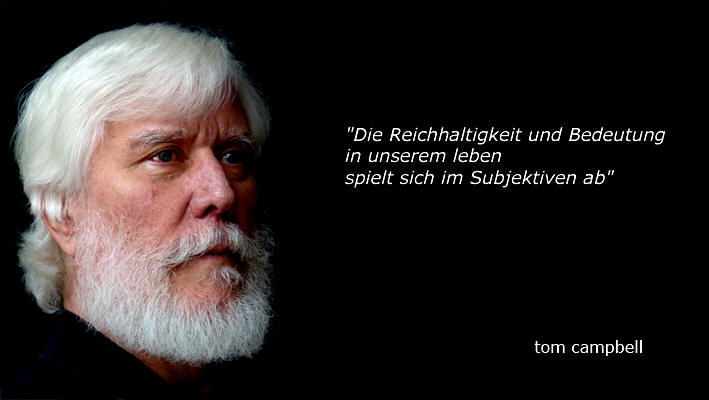
In dem Augenblick, wo wir "Dinge" auch außerhalb und an und für sich außerhalb des Datums (Information) in Bewusstheit vermuten, kommt der gesamte Rattenschwanz in's Spiel:
Materie
Kausalität
Gesetze
Wissenschaft
Disziplinen
etc.
Vor allem aber die scheinbar unerschütterliche Religion des Materialismus. Selbst einstein war da einfach noch zu borniert, erkannte seinen "Kardinalfehler" erst spät im leben. Siehe "Marseille Workshops" von tom.
Demnach muß die wahre Philosophie jedenfalls idealistisch seyn; ja, sie muß es, um nur redlich zu seyn. Denn nichts ist gewisser, als daß Keiner jemals aus sich herauskann, um sich mit den von ihm verschiedenen Dingen unmittelbar zu identificiren: sondern
Alles, wovon er sichere, mithin unmittelbare Kunde hat, liegt innerhalb seines Bewußtseyns.
Ueber dieses hinaus kann es daher keine unmittelbare Gewißheit geben: eine solche aber müssen die ersten Grundsätze einer Wissenschaft haben. Dem empirischen Standpunkt der übrigen Wissenschaften ist es ganz angemessen, die objektive Welt als schlechthin vorhanden anzunehmen: nicht so dem der Philosophie, als welche auf das Erste und Ursprüngliche zurückzugehn hat.
Nur das Bewußtseyn ist unmittelbar gegeben,
daher ist ihre Grundlage auf Thatsachen des Bewußtseyns beschränkt: d.h. sie ist wesentlich idealistisch. – Der Realismus, der sich dem rohen Verstande dadurch empfiehlt, daß er sich das Ansehn giebt thatsächlich zu seyn, geht gerade von einer willkürlichen Annahme aus und ist mithin ein windiges Luftgebäude, indem er die allererste Thatsache überspringt oder verleugnet, diese, daß Alles was wir kennen innerhalb des Bewußtseyns liegt. Denn, daß das objektive Daseyn der Dinge bedingt sei durch ein sie Vorstellendes, und folglich die objektive Welt nur als Vorstellung existirte, ist keine Hypothese, noch weniger ein Machtspruch, oder gar ein Disputirens halber aufgestelltes Paradoxon; sondern es ist die gewisseste und einfachste Wahrheit, deren Erkenntniß nur dadurch erschwert wird, daß sie gar zu einfach ist, und nicht Alle Besonnenheit genug haben, um auf die ersten Elemente[11] ihres Bewußtseins von den Dingen zurückzugehn. Nimmermehr kann es ein absolut und an sich selbst objektives Daseyn geben; ja, ein solches ist geradezu undenkbar: denn immer und wesentlich hat das Objektive, als solches, seine Existenz im Bewußtsein eines Subjekts, ist also dessen Vorstellung, folglich bedingt durch dasselbe und dazu noch durch dessen Vorstellungsformen, als welche dem Subjekt, nicht dem Objekt anhängen.
arthur schopenhauer, zur idealistischen Grundansicht.
Wobei schopenhauer, ähnlich wie manfred spitzer, die Dichotomie nicht wirklich bemerkt, dass das "Gehirn" ja ebenso zu dem illusionären Komplex des "Äußerlichen" gehört. Während man damals schopenhauer vorwarf, dass er zu tief den Schnitt auf Seiten des Idealismus getan hatte, ist heute klar, er war lange noch nicht tief genug.


13.11.2025 n. Chr. 08.51 Uhr
Alter Schwede, das war wieder ein Traummarathon. Viel verschiedenes, doch bis auf eine kleine Szene nichts emotional wirklich belastendes. Zwischendurch für wohl 90 Minuten wachgelegen, Kurz hatte ich darüber nachgedacht, ob jesus in Indien war, es wird da ja viel spekuliert
Vor dem DSE und dem delayed Quantum Choice Eraser Experiment hätte ich mir eine Reise von jesus nach Indien im Grunde konventionell vorgestellt, also zu Fuß oder auf dem Rücken eines Kameles, Pferdes, Elephanten oder was weiß ich. Heute, noch bereichert durch die Augenzeugenberichte um neem karoli baba, bhagawan nityananda und ramana maharshi herum, sehe ich, dass für solch eine Ortsveränderung (Palästina --> Indien) nicht unbedingt mehr eine Reise von Nöten ist. So reicht es ja, dass niemand weiter etwas mitbekommen hat (Messung !!)wann er wo los ist, und wann wie angekommen. Also auf Deutsch, es herrscht völlige Unschärfe, meinetwegen geht jesus um irgendeine Ecke und wird von niemandem mehr gesehen (Messung), und dann kommt er aus dem Wald im Himalaya (keine Messung) und begibt sich in einen Tempel, trifft jemanden, nur mal als Beispiel. Von neem karoli baba gibt es eine Menge ! von Augenzeugenberichten diesbezüglich
Es gab also keine Reise zwischen diesen beiden Orten.
Unmöglich ?
Nein, Standard ...
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
Prof. tuscott, Australian National
University, 27 Mai 2015
"Experiment confirms quantum
theory weirdness" (link)
Übrigens funktioniert das für jeden von uns so, auf dem "Microlevel". Konnten wir genauer hinschauen, würden wir bemerken, dass erst dieses Pixel den Grenzbereich des Körpers darstellt, im nächsten Moment das nächstgelegene. Und es gab keine "Reise" von Pixel zu Pixel. Sondern erst galt dieses, dann jenes.

Da also Information "Raum" als solchen nicht kennt, also er ihr nicht inhärent ist, sondern sie diesen bloß darstellt, letztlich dein Nachbar auch nicht weiter weg oder dran ist, als der Andromeda-Nebel. So gesehen ist eine "masselose" Ortsveränderung natürlich eine der einfachsten Übungen. Es wurde ja auch franzi und mir im April 2020 die Masselosigkeit des Mondes gezeigt, ganz offen. Und damit logischerweise die "Digitalität" (Quantum) dieser auf information beruhenden wirklichkeit. Und wenn der Mond schon masselos digital seinen Ort verändern kann, ohne von A nach B eine Strecke zurück gelegt zu haben (siehe auch Zitat tuscott), warum sollte nicht auch jesus erst in Palästina und dann im nächsten Δ T in Indien sein ? So nennt es tom das "PSI Unschärfe-Prinzip", was salopp gesprochen soviel heißt, dass wirklichkeit sich nicht wirklich an "physische" Regeln zu halten braucht, in dem Augenblick, wo keiner hinschaut, keiner weiß, keine Daten vorhanden, keine Messung durchgeführt wird.
Denn die (Schein-)"physische" Konsistenz und Kohärenz wird ja nicht beeinträchtigt.
Es ist genau wie im Traum, man ist erst "hier", und im nächsten
Moment völlig woanders. Was daran noch interessant ist, man wundert sich nicht
einmal, dass man mit einem Male völlig woanders ist. Die Allermeisten würden das
physiologisch oder psychologisch interpretieren, erklären wollen, doch ich würde
sagen, dass wir im Traum einfach wissen, dass information letztlich genau so
funktioniert, oder funktionierten kann, und uns deshalb nicht wundern
(und auch, weil wir das aus anderen wirklichkeiten zur Genüge kennen). Dann
jesus, neem karoli baba, bhagawan nityananda diese wirklichkeit vielleicht
garnicht so wahrgenommen haben, wie wir, sondern mehr als das, was es hier
faktisch ist, nämlich: ein Traum.
Dafür würden auch die psychologischen Beobachtungen von ram dass, in Bezug auf
maharaj ji passen. So war ram dass ja nun wirklich geschult, und er hatte diese
präzise analytische Beobachtungsgabe auch auf neem karoli baba angewandt. Mehr
als einmal ram dass es in seinen Vorträgen erwähnte, dass maharaj ji oft den
Eindruck machte, als wäre er in dem Augenblick oder kurz nach den "lilas" nicht
"anwesend", als wüsste er garnicht, was er gemacht hat. Das deckt sich, wie wir
eben auch im Traum agieren, wir machen vielleicht etwas "physisch unmögliches",
doch im Traum fällt es uns zumeist garnicht auf (wenn überhaupt). Also da gibt
es große Überschneidungen, dass eben die "babas", gurus" und so weiter, diese
wirklichkeit eher so erleben, wie wir einen Traum. Und damit allerdings
richtiger liegen, als wir ...
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
Prof. tuscott, Australian National
University, 27 Mai 2015
"Experiment confirms quantum
theory weirdness" (link)


16.11.2025 n. Chr. 09.15 Uhr
Wieder von 4-7 Uhr wach gelegen, doch die Zeit wird zum Nachdenken genutzt, da "!draußen" ist ja jetzt eh nicht viel zu verpassen. Was mir noch zum DQCEE und aber auch DSE einfiel, war, dass es wohl echt einige "Wissenschaftler" gegeben haben muß, welche im Ernst zuflucht zu der Kindererklärung genommen haben, dass ein atomares oder subatomares "Teilchen" einen recht komplexen Versuchsaufbau versteht, welchen Milliarden von menschen mit einem Billionen mal größeren "Gehirn" nicht zu verstehen in der Lage sind. Und dann auch noch weiß, was von ihm erwartet wird, je nachdem, ob daten des "welcher Weg" vorhanden sind, oder nicht, und dann darüber hinaus auch noch als ein im Anflug auf den Detektor dazu beiträgt, als "Pünktchen" entweder einen "Haufen" zu bilden, oder eben das Wahrscheinlichkeitsverteilungsmuster. Achso, das "Teilchen" kann somit natürlich auch von sich aus seine Bahn wählen, und somit selbsttätig fliegen. Hätte damit ja auch garnicht ausgesendet werden müssen, es kann ja alles selber machen ...
Gut, heute wissen wir, dass man höchstwahrscheinlich bei allen Quantenexperimenten davon ausgehen kann, dass sich faktisch nichts zwischen dem Emitter und Detektor "getan" hat. Es gibt das Signal auf oder in dem Empfänger (Detektor) mit einem Zeitstempel und einer Ortskoordinate, dennoch aber dieses "Ding", von welchem man annahm, dass es im Empfänger eben dieses Signal auslöst, nie irgendeinen Weg zurück gelegt hat.
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
Prof. tuscott, Australian National
University, 27 Mai 2015
"Experiment confirms quantum
theory weirdness" (link)
Ehrlich gesagt, weiß ich garnicht mehr, was man alles noch anführen muß an Fakten vom Boden, bevor selbst ein mensch mit nur halbwegs logischen Vermögen von allein zu dem Schluß gelangen muß, dass er es hier mit einer Art virtuellen wirklichkeit zu tun haben muß.
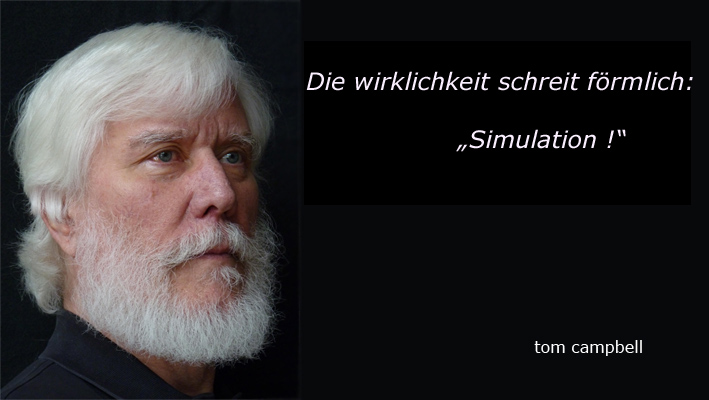
Cum grano salis gesagt von tom, wirklichkeit schreit es förmlich für denjenigen, welcher sich kümmert. Hartnäckig kümmert. So hätte ich es früher nie gedacht, dass man in dieser wirklichkeit richtig hieb- und stichfeste Beweise wird finden können, dass diese wirklichkeit nicht wirklich wirklich ist.
Hier tom, nach einer kleinen Einführung über die "done people":
jegliche Form von wirklichkeit ist eine virtuelle wirklichkeit.
Ob nun im Traum, das "Hier", einer OBE, NDE, dem Bardo, dem luziden Traum, der Nach"tod"wirklichkeit, und so weiter - es ist alles virtuell.
Bewusstheit ist ohne Virtualität nicht möglich.


17.11.2025 n. Chr. 08.13 Uhr
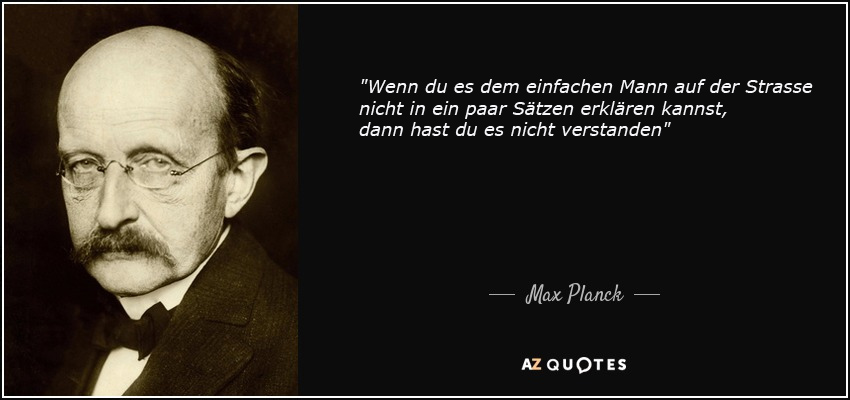
-4°C wird für das Wochenende angesagt, also noch etwas Zeit, alle frostempfindlichen Pflanzen herein zu holen. Sonst doch wieder etwas meinungslos nach einer Nacht mir reichlich und abwechslungsreichen Träumen. Da muß man erstmal wieder herausfinden, um wieder ganz im Datenstrom, der "hier und jetzt" heißt, zu sein. Doch man realisiert auf diese Weise doch auch recht gut: Bewusstheit ist nur in Virtualität möglich. Da paßt es ganz gut, was tom gestern herausgebracht hat. Und tom wird auch gleich am Anfang von donna zu seiner Aussage im Buch (my big ToE) gefragt, dass nämlich auch die höheren wesen, und selbst "the big Cheese" (ein Synonym für lcs ?) eine virtuelle wirklichkeit benötigt, um sich in einer Bewusstheit (wieder) zu finden. Bewusstheit bedeutet ja auch notwendig eine Subjekt-Objekt Struktur, also dass es etwas perzipierendes gibt, und dann eben das Perzipierte. Jedenfalls schonmal auch die wesen, die wir ganz anderen, weit höheren "Realms" zuordnen, und welche hier in dieses Game auch überhaupt nicht hinein passen würden, dennoch in "derselben Nummer" stecken, auch ihre wirklichkeit ist letztlich "nur" virtuell.
Es beginnt gleich mit diesbezüglicher Frage
Doch im Grunde ist das Alles auch nicht mehr, als logisch, wenn man halt die natur von Bewusstheit, wie auch wirklichkeit formal so einigermaßen verstanden hat. Eine Subjekt-Objekt Struktur lässt sich nur in Virtualist erzielen. Am Grundprinzip ändert sich ja auch für "höhere wesen" überhaupt garnichts, da ja auch diese eine iuoc darstellen (müssen), welche halt - wie alle anderen auch - daten erhalten, welche dann deren jeweilige "wirklichkeit" formen. Doch das Ganze wird sozusagen noch zur "Binsenweisheit", wenn man sich überlegt, dass Information das einzig Echte ist, und alles andere ohnehin nicht mehr, als Illusion. Nur klar, wir nehmen diese reine Information als solche nicht wahr, sondern als Tisch, Monitor, Lebenspartner, Depression, Kälte, Wiese etc.
In jedem Videogame besteht alles in den Game ja auch nur aus ein- und demselben Zeugs. Information.

Mal spekuliert, weil soweit habe ich noch nicht mich hinein vertieft, dass information als solche kein Gegenstand einer Wahrnehmung sein kann, ist es dann notwendig, dass sie sich eine Form gibt, um eben Gegenstand von Wahrnehmung überhaupt sein zu können, innerhalb dann eines "Subjekt-Objekt" Paradigmas, welches wir als Bewusstheit bezeichnen. Interessanterweise heißt es ja auch In -Form ation. Es steckt schon im Wort mit drin. Nebenbei, das Gegenteil von "in" wäre "ni", also ni, wie wir es von "Nihilismus" oder "Nirwana" kennen.
So ist mir auch noch eingefallen, was es für enorme Vorteile mit sich bringt, wenigstens erstmal nur die formale Struktur, Natur, Aufbau von wirklichkeit einigermaßen zu kennen, weil das so viele Implikationen mit sich bringt, welche dann bereits viel über den (möglichen) oder wahrscheeinlichen "materialen" Ablauf hier "verraten". Da kommen wir dann schon in die Nähe der "hermetischen Gesetze", nur eben mit dem Vorteil behaftet, dass das Ganze nicht aus einer Form von Mystizismus entspringt, sondern nicht mehr sind, als ganz "normale" Implikationen einer auf Information beruhenden wirklichkeit, respektive "Subkekt-Objekt-Struktur".
Das "Materiale" hier, also das schlichte, einfache, alltägliche leben ist ja auch letztlich nicht begreifbar, wenn man überhaupt garnicht weiß, wo man sich hier befindet, und warum, wie das Ganze überhaupt funktioniert, und so weiter.
»Die Welt ist meine Vorstellung« – ist, gleich
den Axiomen Euklids, ein Satz, den Jeder als wahr erkennen muß, sobald er ihn
versteht; wenn gleich nicht ein solcher, den Jeder versteht, sobald er ihn hört.
Diesen Satz zum Bewußtseyn gebracht und an ihn das Problem vom Verhältniß des
Idealen zum Realen, d.h. der Welt im Kopf zur Welt außer dem Kopf, geknüpft zu
haben, macht, neben dem Problem von der moralischen Freiheit, den auszeichnenden
Charakter der Philosophie der Neueren aus. Denn erst nachdem man sich
Jahrtausende lang im bloß objektiven Philosophiren versucht hatte, entdeckte
man, daß unter dem Vielen, was die Welt so räthselhaft und bedenklich macht, das
Nächste und Erste Dieses ist, daß, so unermeßlich und massiv sie auch seyn mag,
ihr Daseyn dennoch an einem einzigen Fädchen hängt: und dieses ist das
jedesmalige Bewußtseyn, in welchem sie dasteht.
Diese Bedingung, mit welcher das Daseyn der Welt unwiderruflich behaftet ist, drückt ihr, trotz aller empirischen Realität, den Stämpel der Idealität und somit der bloßen Erscheinung auf; wodurch sie, wenigstens von Einer Seite, als dem Traume verwandt, ja als in die selbe Klasse mit ihm zu setzen, erkannt werden muß.
arthur schopenhauer, WaW II, Kapitel 1. Zur idealistischen Grundansicht (Link)
Hammer, oder ? "als dem Traume verwandt, ja als in die selbe Klasse mit ihm zu setzen, erkannt werden muß". Und jetzt packen wir "in die selbe Klasse" noch die wirklichkeiten der OBEs, der luziden trääume, der NDEs, des Bardo (toms Übergangswirklichkeit), die astralen und medialen "Realms", die drogeninduzierten wirklichkeiten, die wirklichkeiten der "höheren Wesen", das "Jenseits" und sonstige noch mit hinein, und voila ?
Richtig, es gibt keine Bewusstheit außerhalb von Virtualität.
"Dem Traume verwandt", das trifft es gut. Es ist eine Familie, das Ganze. Es sind halt immer nur wieder andere, oder anders strukturierte Spiele, in welchen du dich wieder findest ...


Und selbst gott, will er, sie, es mitmachen, muß sich irgendeine Figur aussuchen oder geben und in diese "Subjekt-Objekt" Struktur eintauchen. Anders geht es halt nicht, aufgrund der Eigenschaften und demgemäß den Implikationen von information.

29.11.2025 n. Chr. 08.48 Uhr
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
Prof. tuscott, Australian National
University, 27 Mai 2015
"Experiment confirms quantum
theory weirdness" (link)
Satte 9,0°C in der Bude, dank der relativ milden Temperaturen draußen. Aber trüb und duster ist es, nieselig, halt ein typisches Novemberwetter, bei welchem man gerne drinnen bleibt. Blöd ist, das ich mit den Flugzeugen nicht raus kann, und noch blöder, dass sie alle fertig sind, alles passt, der Schwerpunkt stimmt, etc. Oft muß ich die Front um ~2-3cm verlängern, und bis das Ganze dann wieder so aussieht, als wäre nichts geschehen, sind mal eben 15-20 Stunden weg ...
Da muß ich dann noch ein Bild machen, wie der fertige Flieger jetzt aussieht. Auch bin ich noch am überlegen, ob ich aus Österreich mir einen kaputten "Hotliner" hole, welchen ich zwar überhaupt nicht brauche, doch einfach, um wieder handwerklich etwas Anspruchsvolles zu tun zu haben.
Noch einmal zurück zu den "Channelings", was mir vorhin grad so einfiel, ist, dass da auch gut die "lcs" dahinter stecken kann. Mit Betonung auf "auch", denn grundsätzlich, aufgrund der Unschärfe, ist es nicht wirklich nötig, dass da ein eigenständiges wesen (iuoc) kontaktiert wird. Diesen Job kann genau so gut "das System" übernehmen, und "mimt" einfach dieses oder jenes wesen. So macht es stets Sinn, wirklichkeit aus der "Computergameperspektive" zu betrachten, denn es ist ja die beste Analogie, welche wir derzeit haben, um wirklichkeit, oder die natur von wirklichkeit erfassen, beschreiben zu können.

Gut, nun hatte ich auch das "Glück", dass mir die "Digitalität" dieser wirklichkeit, also dass es in gewissem Sinne wirklich ein Videogame hier ist, und wir, wie in "Tron", so richtig drin stecken, auch live und in Farbe gezeigt, am 8 April 2020 gegen 19.30 Uhr, interessanterweise, was für ein Zufall ...
Das habe ich aber erst dieses Jahr, also 5 Jahre nach dem Vorfall, herausgefunden. Und diese Digitalität von wirklichkeit, dass damit "Masse" und damit letztlich jegliche "Solidität" eine vollkommene Illusion ist, wurde auch meiner damaligen freundin ganz offen gezeigt, welche aber aber auch schon zuvor oft den Spruch gebracht hat: "scheiß Spiel, aber geile Graphik".
Es hat enorme Konsequenzen, wie auch Vorteile, wenn man den Aufbau von wirklichkeit vom "formalen" Ende her verstanden, oder jedenfalls so halbwegs verstanden hat. Die Konsequenzen sind natürlich besser Implikationen zu nennen, doch die ganze Geschichte so halbwegs verstanden, überhebt man sich schnell vieler Fragen, welche sich nur dadurch ergeben, dass man wirklichkeit aus den physischen Brillengläsern heraus betrachtet. So brauche ich nicht unbedingt "Evolution", die wesen, von pflanze über tier bis zum mensch können auch einfach aus dem Nichts "run-Button" gedrückt, hier begonnen haben, wie in jedem anderen Videogame auch. Dass es auf irgendeine Art eine Form von Evolution gegeben haben muß, von vielleicht anfänglich platonischen Körpern bis dann hin zu lebewesen, ist schon klar, nur bezweifle ich, dass diese Evolution so statt finden muß, wie sie tom campbell beschreibt.
So erstreckt sich bei mir die Betrachtung auch des "Weltlichen" immer mehr aus eben dieser Perspektive, was allerdings ein sehr langsamer Prozess ist, denn es bedeutet ja nicht weniger, als die gesamte, Jahrzehnte lang anerzogene und gewohnte, sinnliche Weltsicht abzulegen, und wirklich Alles ! aus der "Videogameperspektive" zu betrachten. Damit nehme ich überhaupt nicht die Ernsthaftigkeit aus dem Dasein heraus, sondern
ganz im Gegenteil
, es geht hier um etwas, und es geht hier richtig um etwas, hier ist nichts beliebig, nicht eine Sekunde ist bedeutungslos. Seit ich weiß, dass ich in einer Art Videogame stecke (bei welchem es ja um etwas geht), nehme ich leben in bestimmten Aspekten ernster, als je zuvor. Doch interessanterweise verlieren aber auch die "negativen", leid- und schmerzvollen Momente ein wenig ihren Schrecken. Man weiß, dass es halt dazu gehört, und man nun eben da durch muß.
""Deal with it", thats the Name of the Game"
tom campbell
Und !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wir alle kommen hier eines schönen Tages auch wieder heraus.
Also, was soll's, genießen wir den Ritt, so gut es geht, machen das Beste draus, und bei dem, was vielleicht belastet, dann mehr wie harte Arbeit sich ausnimmt, können wir uns immerhin damit trösten, jetzt ordentlich Punkte einzufahren.

30.11.2025 n. Chr. 08.48 Uhr
Relativ "satte" 9,2°C in der Bude. Um diesen Bereich herum merkt man fast jedes Zehntel °C Zu- oder Abnahme. Und vieles auf dem Zettel, was ich hier bringen möchte, doch wahrscheinlich nicht heute. Über gestern und vorgestern hat sich nochmal etwas innerlich getan, vom Innerlichen her war es dann gestern Abend so, dass es noch einmal eine Stufe tiefer "gesackt" ist, dass man sich hier sozusagen "im geiste gottes" befindet. Nicht, dass ich das auch nicht auch bereits schon davor "wusste", aber es ist einfach etwas anderes, wenn es auf der "Gefühlsebene" (ich nenne es mal so) geschieht, wie eine Art von Wissen, welches man aber dummerweise nicht in Worte kleiden kann. So dachte ich mir heute morgen, dass ich so langsam vielleicht eine Haltung zum Dasein, "leben" und wirklichkeit bekomme, wie sie der Durchschnittsinder schon ab Kindesbeinen hat.
Diese Zigaretten wurden damals auch in Indien verkauft, krishna das meint, sich noch an Plakate erinnern zu können ..
Das ist der Punkt, ob ich nun Maya sage oder Show, kommt letztlich auf das Gleiche heraus, und - es geht halt auch wieder vorbei (passing). Man hat halt eine Rolle für gewisse Zeit inne, aus gewissen Gründen, welche wir besser oder schlechter zu ergründen in der Lage sind. Und dann ist das Theaterstück vorbei, und wir sind wieder entlassen, frei, uns eine andere Rolle auszusuchen, welche uns ein weiter lernen lässt. Jeder Schauspieler macht das so, die Rollen werden anspruchsvoller über die Zeit. Überhaupt wohl beinahe jeder es in sich merkt, dass es ihn langweilt, er unzufrieden zu werden beginnt, wenn die Dinge auf der Stelle stehen, es keine Herausforderungen mehr gibt. Klar, für viele befindet sich die Herausforderung noch im Außen, wo es letztlich gar keine Herausforderung gibt, aber das suchen sie auch nur deswegen dort, weil sie erstmal nur am Üben sind, und noch garnicht bereit, die Herausforderungen des Inneren anzugehen. Denn nur darum kann es gehen, worum denn sonst ? Alles andere ist nur - passing Show.
maharaj ji sagte mal zu krishna das, dass er auch nach America kommen wird, und kd hat sich in manchen Podcasts dazu geäußert, dass er nie so richtig verstanden hat, was maharaj ji damit meinte. Er weiß wohl, dass er mal in England war, während des 2ten Weltkrieges, aber das maharaj ji in den USA oder Amerika war, davon hat er nichts mitbekommen. Doch hier, genau wie maharaj ji meinte: "ich werde auch nach Amerika kommen ..."
Nachher kommt dann noch die ganze Polizeiwache des Ortes (in/von New Mexico), und bestärkt ihn, dort den Hanuman-Tempel fertig zu stellen. Und warum die Polizeiwache ? Na, weil maharaji ji über Wochen einen Polizisten gefoppt hat, der den Mann mit der auffälligen Decke immer mal anhalten, und kontrollieren wollte, doch der war stets um die Ecke, und dann spurlos verschwunden. Und das war so in den 80gern, lange nach dem "Tod" von neem karoli baba.
"ich werde auch nach Amerika kommen"
maharaj ji zu kd
"The atoms
did not travel from A to B.
It was only when they were
measured at the end of the
journey
that their wave-like or
particle-like behavior was
brought into existence," he said.
Prof. tuscott, Australian National
University, 27 Mai 2015
"Experiment confirms quantum
theory weirdness" (link)



04.12.2025 n. Chr. 08.11Uhr
Jetzt hat es einigermaßen geklappt
Nur vielleicht 1-2 Stunden zwischendurch wachgelegen heute Nacht, und nicht mehr 3-4. Immerhin noch 8,0°C in der Bude, die recht ambitionierte 7°C-Marke ist noch nicht erreicht. Sooo, und nun stellt euch mal eine Fläche vor, 4:3, hochkant, schiefergrau, fast schwarz. Nun platziert vertikal auf diese Fläche 4 dünne, helle Linien, gleichmäßig verteilt, welche zu den Rändern hin leicht unscharf sind, also ein wenig hinein fließen in das Schiefergrau. Und dazu, in demselben Stil, 6 horizontale Linien, leicht unscharf, etc. Da ergeben sich natürlich Knotenpunkte, und an diesen Knotenpunkten stellt sich ein etwas größerer (als die Linie) heller Punkt ein, ebenfalls unscharf an den Rändern.
So ...
Und genau so stellte sich eines Nachts, oder Abends mein schiefergraues und lichtdichtes Verdunkelungsrollo dar, Velux "Qualitätsware" :-). Das war natürlich faszinierend, wie Spock es vielleicht beschreiben würde, ich schaute es mir genau an, zählte die Linien, und überlegte, wie es zu Stande kommen oder was mir damit wohl gesagt, gezeigt werden könnte. Um sicher zu stellen, dass ich kein Gitternetz aus staub auf den Augen, oder irgendeine Brille auf hatte, schüttelte ich den Kopf in alle Richtungen, betrachtete das Rollo mal mit geneigtem Kopf nach links, nach rechts, doch egal, was ich für Faxen machte, das Muster blieb bockstabil. Im Grunde, mal formal gesehen, war, was mir dort gezeigt wurde, ähnlich spektakulär, wie der durch den Himmel ruckelnde Mond. "Material" betrachtet natürlich nicht, denn was ist schon ein Rollo gegen einen gigantischen Mond. Nur, dieser Effekt hatte mich dann nicht mehr sooo "umgehauen", weil, dass mir die "digitale" natur von Flächen, also generell, woraus sich so unser Sichtfeld zusammensetzt, gezeigt wurde, das begann schon ~ 3 Jahre zuvor.
Und so ungefähr für 3 Jahre war es nur ab und an die weiße Kachelwand im Bad, welche mir präsentiert wurde des Nachts, oder Abends (etwas Licht ist ja fast immer) nicht als einheitlich dunkelgraue Fläche, sondern als leicht waberndes Muster heller und dunkler Bereiche, leicht ineinander übergehend, und - wie gesagt - auch nicht wirklich fest stehend, sondern eher wie ein Rauschen, wie man es von früher vom Fernseher kennt. Wobei die einzelnen hellen und dunklen Bereiche so eine Größe von 3-4 cm haben. In der Summe sind sie wieder dunkelgrau, aber eben nur grob, sehr grob dargestellt. Da stand ich dann davor, schaute es mir eine weile an, und fragte mich, "warum nur die Kacheln ?", denn schaute ich zur gemalten weißen Wand, so präsentierte sich diese mir in der (fast) Dunkelheit, wie ich sie gewohnt war, ein einheitliches Dunkelgrau.
Doch jetzt, seit vielleicht 6 Monaten, häuft sich dieses Phänomen und scheint sich mittlerweile auf alles ausdehnen zu wollen. Es taucht nur in einem bestimmten Zustand auf, nämlich, wenn man sich in's Bett legt, noch nicht eingeschlafen ist, und mann aber dann doch noch mal hoch muß. Das ist der typische Zustand, von welchem die allermeisten reden, wenn oder wann sie es schaffen, in eine OBE zu gelangen. Das scheint eine magische Phase zu sein. Es ist übrigens nicht die Phase vor dem Einschlafen. So sieht es zwar äußerlich aus, sondern es ist die Phase des Ablösens des Hauptdatenstromes (in welchem der Player sich als solcher wahrnimmt). Es gibt in dem Sinne kein "Einschlafen", das ist natürlich Käse, sondern eben der Hauptdatenstrom wird ausgephast, "abgenabelt", wenn man so will, und das scheint eine, oder die bevorzugte Phase zu sein, in welcher (für Anfänger) mehr zugelassen werden kann. Dieses "Ausphasen" des Datenstromes stellt sich hier natürlich als Einschlafen dar, doch sollte man stets im virtuellen Hinterkopf behalten, dass hier nichts, aber überhaupt nullkommagarnichts "physisch" ist. den Einschlafenden ALS SOLCHEN: gibt es nicht.
Naja, mittlerweile ist es soweit, dass mir beinahe jeden Abend in dieser Phase es gezeigt wird, sofern ich die Augen aufmache, und mich nochmal in's Bad bewege. Doch nun ist es nicht mehr nur die weiße Kachelwand, sondern beinahe Alles (ich muß mal genauer darauf achten), alle Flächen, halt alles, was so "die Wohnung" ausmacht, auch mit den Gegenständen, wird in dem grob gerasterten "Wabern" mir dargestellt. Es ist von der Form letztlich genau so, wie sich bei Neo im Film Matrix nachher alles darstellt, Wände, "lebewesen", Alles stellt sich nur als ein fließender Code dar ....

Auch überlege ich natürlich, warum mir genau das, also warum mir im Grunde letztlich optische Phänomene gezeigt werden, und ich führe das darauf zurück, dass ich ja zeitlebens, jedenfalls so ab dem achten lebensjahre, an der "Illusionität" von gezeigter (eingephaster) wirklichkeit mal mehr mal weniger intensiv herumkaue, und vielleicht jetzt ein wenig "die Frucht ernte", oder besser die Gnade erhalte (über das Gezeigte), dass ich all die Jahre nicht falsch lag.


06.12.2025 n. Chr. 08.30Uhr
7,8°C in der Bude, kommt mir aber nicht so frisch vor,
wahrscheinlich weil ausgepennt. Dennoch viel wach gelegen, nachgedacht darüber
wieder mal, inwieweit wir überhaupt Urheber "unserer" Gedanken sind, und kam zu
dem gleichen Ergebnis, wie sonst auch - wir denken nicht, wir werden gedacht,
wie es bruno gröning formuliert. Natürlich nehmen wir das so nicht wahr. Alles,
was so in unserer Bewusstheit vor sich geht, vor dem Subjekt der Erkenntnis,
rechnen wir "uns" zu, und implizieren dabei aber eben auch "von uns". Doch das
sind natürlich 2 paar Schuhe, nur weil man es "als sein Gedanke" oder Idee
wahrnimmt, muss sie deswegen nicht zwangsläufig aus "einem selbst" stammen.
Übrigens scheint mir auch eine Art von neuem Paradigma nun so langsam Einzug zu
halten, es scheint so, als würde wirklichkeit seit ~ 200 Jahren den Vorhang ein
wenig durchscheinender werden lassen. Stellt euch mal vor, es gäbe ein Spiel,
durcch welches - je nachdem, wie gut ihr euch macht - ihr mehr Ausgeglichenheit,
innere Ruhe, "Weisheit", Versöhnung mit dem alltäglichen Leben, Verständnis für
andere ... etc. erlangen könnt. Zwar man nicht materielle Dinge erhält, der
Partner noch immer dieselben Macken hat, der Nachbar muffelig wie sonst auch,
der Hund nicht besser pariert, doch ihr eben mit all dem besser klar kommt (deal
with it), als zuvor. "ok", würden dann wohl viele zu recht sagen, "wenn es
solche Konsequenzen haben kann, dann ist es auch kein Spiel mehr". Eher würde
man es dann als "spielerisch" bezeichnen,
"spielerisch erlangte er diese Fähigkeiten".
Der Spielecharakter stünde vielleicht noch immer im Vordergrund, doch man weiß eben dennoch, dass es nicht um nichts geht, sondern etwas Substantielles erlangt werden kann. Meint, mit einem Male ist das Spiel nicht mehr beliebig, nicht mehr unerheblich, sondern jeder Zug, welchen man vornimmt, ist von potentieller, wahrscheinlich sogar aktueller Bedeutung. Jeder.
Das ist es, was mir passiert ist in all den Jahren, seitdem ich
weiß, dass es hier ein "online Game" ist - nehme ich es ernster, als je zuvor.
Weil ich eben auch "weiß", dass es hier faktisch um etwas geht, um nicht mehr
oder weniger, als - wenn man so will - das Wachstum der seele. Wäre ich
über das Doppelspaltexperiment nicht gestolpert, auch nicht über bruno gröning,
therese neumann (etc.) und schließlich neem karoli baba, ich wäre vielleicht
noch in dem Glauben, diese scheinbar materielle Chose hier sei echt, sie
entspränge auch hier, und ist somit der wahre Jakob. Doch damit einher ginge
dann natürlich Materialismus, Egoismus und letztlich Nihilismus. Jetzt und mir
das Meiste, und die Zeit drängt, sonst verpasst man das (scheinbare) leben.
Nur - die Haltung fährt keine "Punkte für die seele" ein. Je mehr sich so
verhalten, desto ineffizienter wird das Spiel Zwar kann man noch Krankheit,
Krisen, Krieg und andere Kalamitäten einstreuen, damit die Teilnehmer immerhin
ein wenig "Punkte für die seele" einfahren (suffering is grace),
doch idealer, und reibungsloser wäre es, wenn die Teilnehmer sich selbst ihre
Felder und Aufgaben suchen, respektive bearbeiten würden, ohne dass man immer
"hinterher" sein muss ...

D.h., lässt wirklichkeit "durchblicken", dass es hier tatsächlich um etwas geht, und es eben nicht alles beliebig und bedeutungslos ist, gerade ! in moralischer Hinsicht, beginnen vielleicht die Ersten, sich von selber ein wenig "zusammenzureißen", wohl um so stärker, je klarer es ihnen gemacht wird, das am Schluss dann "abgerechnet" wird. Jeder, welcher nur ein paar ! NDE-Schilderungen gehört hat, wird eben auch mitbekommen haben, dass diese menschen, die das erlebt haben, danach eine beinahe völlige Transformation durch machen, weg vom Egoismus, weg vom Materialismus. So wissen nun, "oh, es geht ja tatsächlich um etwas". Und um nichts geringeres - sozusagen - als dein "seelenheil".
Und das ist, was ich sagen wollte, wenn ich das Gefühl habe, dass ein neues "Paradigma" die Bühne betritt. Wie schon gesagt, seit mir klar ist, dass das hier ein "Holodeck" ist - nehme ich leben ernster, als je zuvor. Eben weil die Implikationen dieser Erkenntnis es auch mit sich bringen, dass hier eben nichts beliebig ist - alles zählt, alles geht auf's Konto, alles wird gebucht.
Deswegen, denke ich, öffnet sich wirklichkeit hinsichtlich ihrer natur ein wenig, weil es für diejenigen, die im alten Paradigma geistig verharren müssten (in Ermangelung einer Alternative), ein sehr ineffizienter Durchgang hier werden würde. Denn das alte Paradigma ist ja das Newtonsche, alles ist Materie, damit ist auch alles nihilistisch egal. Nur bei denen, und dazu zähle ich mich, denen das die Lust am leben dann verschlägt, oder verschlagen würde, wäre dann so ein Durchgang hier recht ineffizient, man "wobbelt" sich dann einfach nur durch, bis es dann zu Ende ist. Wird einem aber gezeigt, auf die eine oder andere Art, "es geht hier um was", ist der Motor wieder an, das Feuer entfacht, und der Betriebsaufwand der Renderung einer 3D-wirklichkeit lohnt sich wieder so richtig, weil halt ordentlich Buchungen auf den diversen Konten zu Stande kommen. Deswegen vielleicht auch die geradezu "Explosion" der NDE-Schilderungen oder das eben auch "Sehen ohne Augen" nun zugelassen, und in die Menge gestreut wird. Dann, wie schon gesagt, therese neumann, bruno gröning, mirin dajo, roland plocher, wilhelm mohorn, herbert renner, johann grander und als Sahnehäubchen dann natürlich maharaj ji
"Die Leelas fielen von ihm herab, wie Blätter von einem
Baum "
krishna das über neem karoli baba


Und jetzt kann man den Kommentar auch besser verstehen. Übrigens könnten sich in den übrigen Kommentaren auch noch ähnliche Erfahrungen verbergen, hab noch nicht geschaut, bin nur gestern zufällig über diesen gestolpert.